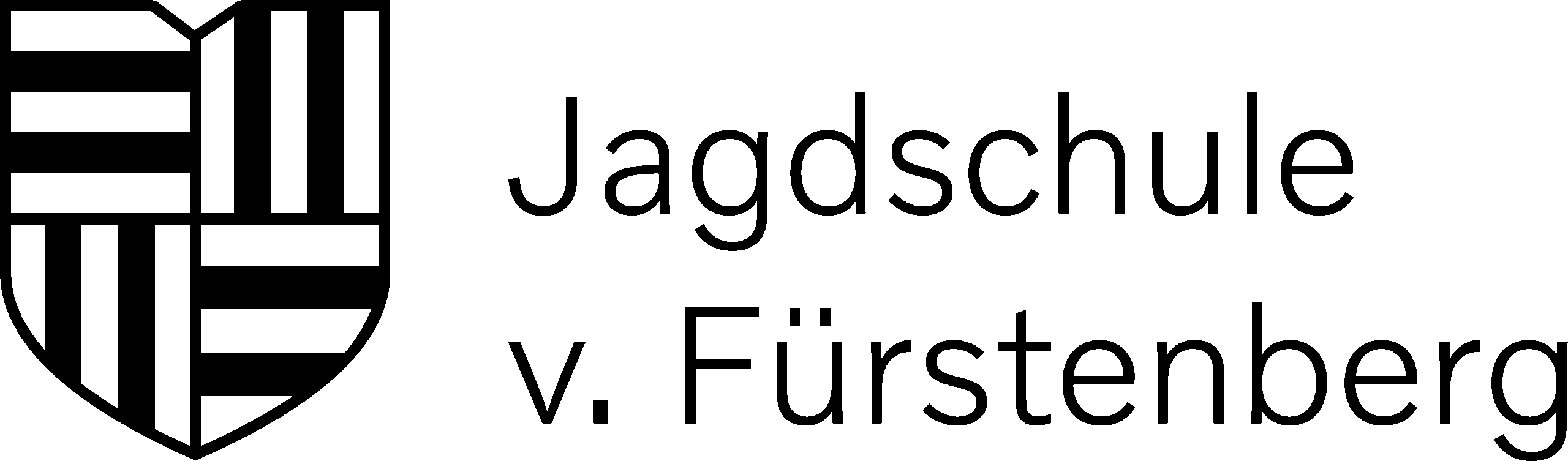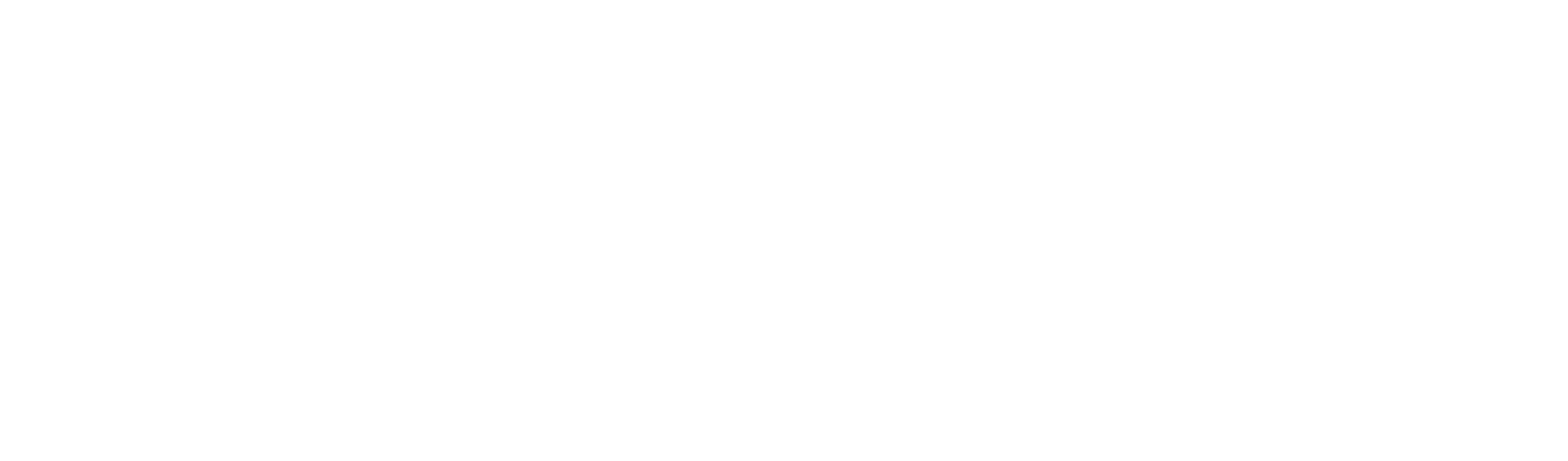Die Drückjagd als harmonisches Zusammenspiel. Der Jagdleiter als Komponist und Dirigent der perfekten Gesellschaftsjagd.
Alle Aspekte rund um die Drückjagd erklärt Revierjagdmeister Roman v. Fürstenberg mit der Erfahrung zahlreicher hochqualitativ organisierter und durchgeführter Drückjagden der Extraklasse. Einige Teile dieser umfangreichen Ausführungen wurden bereits journalistisch in Titelthemenartikeln den Fachzeitschriften Jägermagazin und Sauen veröffentlicht.
Die Drückjagdkarte/ Revierkarte als Planungsgrundlage
Die Grundlage der Drückjagdplanung ist die Revierkarte. Zunächst werden auf der Revierkarte sämtliche potenziellen Einstände markiert und bekannte Wechsel eingezeichnet. Als dann wird das Revier in verschiedene Treiben/ Treibergruppen eingeteilt. Diesen Treibergruppen wird eine Richtung zugewiesen, in die sie treiben und es wird auch in diesem Zuge festgelegt, wie groß die einzelnen Gruppen werden und welche Hunde dort eingesetzt werden. Im nächsten Schritt werden in Kombination aus der Karte, den bekannten Wechseln, den Beobachtungen der letzten Jahre und den Gegebenheiten im Revier die Standplätze draußen im Revier ausgesucht und sinnvoll verteilt sowie in die Karte eingetragen. Diese Drückjagdkarte ist auch als Grundlage für die Beschilderungspläne und kann in den nächsten Jahren sinnvoll genutzt werden. Sämtliche Erlegungen und Beobachtungen werden darin hinterlegt. Insbesondere gute Fluchtwechsel werden darin vermerkt.
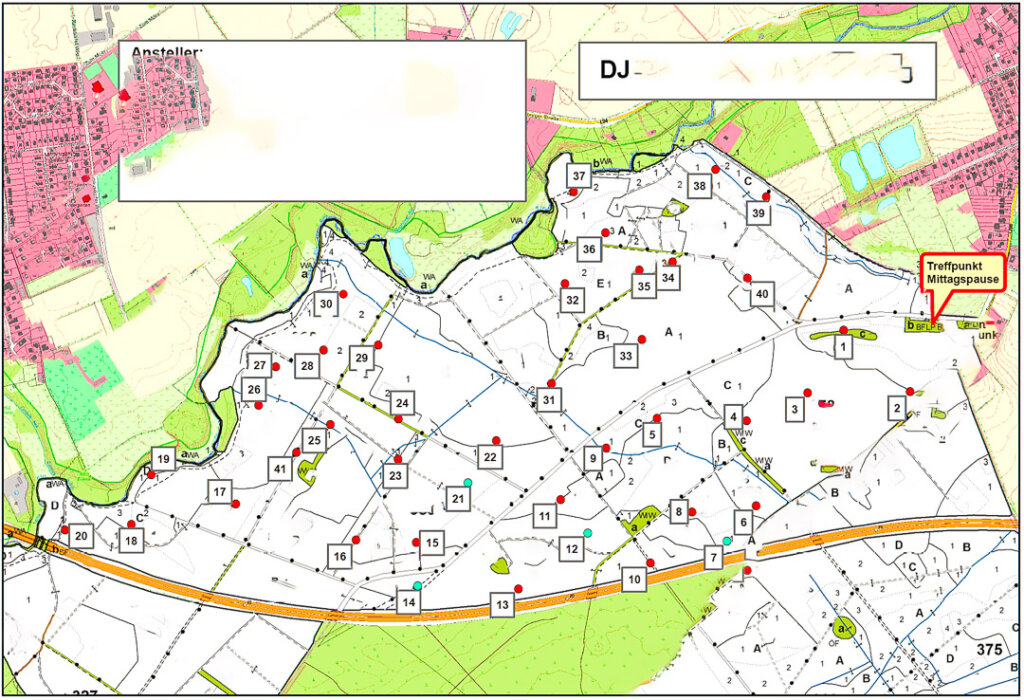
Standplatzwahl bei der Drückjagdplanung

Die richtige Standplatzwahl der Drückjagdstände hat entscheidenden Einfluss auf den möglichen Erfolg der Drückjagd. Schon allein, wenn ein Stand nicht ganz schlecht steht, jedoch circa 30 Meter zu weit von einem Wechsel entfernt ist, der ansonsten noch beschossen werden könnte, oder wenn ein Winkel durch verschiedene Bäume, Bestände und dergleichen nicht passt, kann es vorkommen, dass von einem Stand trotz nicht ganz schlechter Position kein Wild erlegt wird. Der Jagdleiter legt deshalb besonderen Wert darauf, die Stände so anzulegen, dass sie nah an bekannten Wechseln und Fluchtwechseln sind, sodass diese aus guter Entfernung beschossen werden können. Ideal sind hier etwa 30 bis 50 Meter.
Der richtige Ort entscheidet über den Erfolg der Drückjagd
Hinzu kommt die Tatsache, dass die Drückjagdstände nicht zu nah am Einstand sein sollten und es wird berücksichtigt, dass das Wild Dunkelbrücken bevorzugt. Dunkelbrücken sind jene Bereiche, die es ohne helle Bereiche wie Wege, Schneisen und dergleichen zu durchqueren nutzt, um in andere Einstandsbereiche zu flüchten. Insbesondere helle Bereiche werden von flüchtendem Wild nur ungern und dann in hoher Flucht überwunden. Sichere Schüsse sind oft unmöglich. Abgesehen davon bieten Wege durch ihre verdichtete Bauweise keinen sicheren Kugelfang. Hinzu kommt die Tatsache, dass alle Stände gut, mindestens mit dem Trecker, besser mit dem Quad oder dem Pkw anfahrbar sind, um das erlegte Wild schnellstmöglich unter Beachtung der Wildbrethygiene zu bergen. Grenznahe Drückjagdstände werden zwingend durch den Jagdleiter im Vorfeld mit den Reviernachbarn abgestimmt und UVV konform zueinander gekennzeichnet. Auch wenn es sich um verschiedene Reviere handelt, werden sämtliche Stände zueinander so abgesichert, als würde es sich um ein einziges Revier handeln.

Drückjagd: Gute Stände, gute Schützen

Ganz gleich, ob Drückjagd auf Schalenwild oder Treibjagd auf Niederwild. Die Jagd soll am Jagdtag den höchstmöglichen Erfolg bringen. Den Rest des Jahres herrscht somit maximale Jagdruhe. Um einen hohen Jagderfolg zu erzielen, ist es niemals sinnvoll, den Schützen die Standplätze zuzulosen. Gute Stände mit ungeübten Schützen erbringen keinen Jagderfolg. Sehr gute Schützen können zwar auf leichten oder schlechteren Ständen Jagderfolg erzielen, jedoch keinesfalls in der Höhe wie auf einem vielversprechenderen Stand. Der erfahrene Jagdleiter kennt sein Revier und somit auch die vielversprechendsten Stände. Die besten Schützen bekommen diese Stände. Leichte Stände bieten sich für Jungjäger und Drückjagdneulinge an. Wenn die Stände der Schützen im Bereich von Dunkelbrücken an bekannten Fern- und Flucht- sowie Friedwechseln postiert sind, stellt sich schnell Jagderfolg ein. Je ruhiger das Wild vor die Schützen kommt, desto sicherer sind die Schüsse. Hierbei zählt neben dem Tierschutzaspekt die bessere Verwertbarkeit des Wildbrets.
Geeignete Drückjagdstände für Jungjäger
Für Jungjäger nach bestandener Jägerprüfung ist die erste Drückjagd etwas ganz Besonderes. Noch unerfahren ist man mit den Situationen, die sich dort bieten, häufig komplett überfordert. Daher ist es für den Jungjäger sehr empfehlenswert, zunächst einmal als Begleiter und nicht selbst als Schütze an Gesellschaftsjagden teilzunehmen. Mit ein bisschen Zuschauererfahrung kann dann der Start als Schütze auf der Drückjagd erfolgen. Zu Anfang ist es sinnvoll, einen drückjagderfahrenen Begleiter mit auf den Stand zu nehmen. Geeignete Stände für Jungjäger bieten ausreichend viel Übersicht, um das Wild frühestmöglich auf längere Zeit ansprechen zu können. Rundherum haben jungjägergeeignete Drückjagdstände von sich aus einen sehr guten Kugelfang, Fernwechsel bieten sich sehr an, um sie mit Jungjägern zu besetzen. Sind dies doch jene Wechsel, auf denen das Wild nach dem Verlassen des Treibens etwas langsamer und vertrauter kommt und am Stand des Jungjägers vorbeizieht, der dort seine ersten Chancen verwirklichen kann.

Zwangswechsel bei der Drückjagd nutzen

Mögliche Zwangswechsel im Revier oder in den einzelnen Treiben werden auch bei der Drückjagd sinnvoll genutzt. Zäune entlang von Autobahnen oder Straßen ebenso wie Zäune von Forstgattern bieten je nach Lage in der Landschaft eine sinnvolle Leitung des Wildes. Folgt das aus der Dickung getriebene Wild Wird das Wild einer dieser Leitlinien aus Zaun, so kann dort durchaus ein Drückjagdbock passend postiert sehr erfolgversprechend genutzt werden. Achtung! Zäune, die ihre Schutzfunktion im Wald erfüllt haben, beispielsweise wenn die Bäume aus der Äserhöhe des entsprechenden Wildes herausgewachsen sind, müssen abgebaut werden. Zäune nur aufzubauen, um entsprechende Zwangswechsel herzustellen, ist somit nicht erlaubt. Ganz besonders lohnen sich Zwangswechsel an Zäunen, an denen das Wild unter dem Zaun durchgeht oder wo die Zäune eventuell kaputt sind oder enden.
Pro und Kontra Drückjagd- Standkarte
Vielerorts geben Jagdleiter Standkarten an die Drückjagdschützen aus. Darauf meist ein Kartenausschnitt mit dem eigenen Stand zur Orientierung sowie eine Anschusskarte. Ein Kreis mit dem Stand in der Mitte, worin dann anfallende Nachsuchen sowie Wildbeobachtungen mit Uhrzeiten eingezeichnet werden sollen. Der Grundgedanke ist sehr gut: Die Erlangung von Informationen über den Jagdverlauf. Das Problem: Viele Schützen kennen sich nicht aus, können die Richtung ihres Standes erst gar nicht richtig bestimmen und sind überfordert. Hierdurch werden Chancen verpasst und unlesbare Eintragungen angefertigt oder gar die Karten blanko zurückgegeben. Ich bin der Meinung, dass der Schütze sich drückjagdpraktisch auf seinem Stand orientieren soll, um sicher und waidgerecht zu schießen. Anschüsse werden ausschließlich vom Ansteller, der den Schützen am Stand abholt, fachgerecht aufgenommen und markiert. Hierbei weißt der Schütze den Ansteller vom Sitz aus ein. Etwaige besondere Wildbewegungen und Besonderheiten über den Verlauf der Drückjagd nimmt der Ansteller ebenfalls mit auf.

Drückjagdvorbereitung im Revier: Freischneiden der Stände

Der Stand kann noch so gut sein, wenn der Schütze nichts sehen kann oder kein freies Schussfeld hat, wir auch ein guter Schütze nichts erreichen. Es gehört daher bereits zur spät- sommerlichen Drückjagdvorbereitung, sämtliche Drückjagdstände akkurat frei zu schneiden. Breite Schussschneisen und schmale Sichtachsen werden aufgeastet, hohe Grasflächen tief gemäht. Das Mähen erfolgt so, dass das Gras nicht mehr stark nachwächst. Die Motorsäge und der leistungsstarke Hochentaster sowie ein Freischneider und Heckenschere sind die idealen Geräte, um optimale Sicht zu schaffen. Diese anstrengende Arbeit ist zu zweit am effektivsten. Einer astet auf, der andere weißt ihn vom Sitz aus ein. Im Wechsel kann so immer einer eine kleine Pause machen. Mäharbeiten erfolgen simultan.
Pirschwege kennen nahezu alle Jäger aus ihrem herkömmlichen Sinn als leiser Weg zum Hochsitz. Doch gerade dieses leise Angehen eines Ansitzes ist es, was auf der Drückjagd unbedingt notwendig ist.
Auf leisen Sohlen zum Drückjagdstand: Pirschwege
So wird das in der Nähe befindliche Wild nicht unnötig früh hoch gemacht. Bei der perfekt organisierten Drückjagd spielen Pirschwege zu sämtlichen Ständen eine wesentliche Rolle. Alle Stände sind so nahezu lautlos erreichbar und können störungsarm bezogen werden. Um die Pirschwege ordentlich anzulegen, nutze ich gern die größten rückentragbaren Laubblasgeräte von Stihl. Hiermit beseitigt man sämtliches Laub, wie auch Äste zuverlässig. Gras wird mit dem Freischneider bodennah abgemäht. Sofern der Untergrund nicht optimal ist, nutze ich das Stihl Häckselmesser am großen Freischneider, um den Boden sicher freizulegen und den Pirschweg zum Flüsterweg zu machen. Wer diese Pirschwege für die Drückjagd infrage stellt und als unnötig abtut, der beobachte einmal die Lautstärke, mit der mancher Jäger zum Stand poltert. Die Pirschwege eliminieren dieses Problem und überlassen den Jagderfolg der sorgfältig geplanten Drückjagd nicht dem Zufall. Weiterhin zeigen sie immer den korrekten Weg zum Stand und niemand verläuft sich.

Sicherheitssektoren und Schussverbotszonen bei der Drückjagd

Die Sicherheitsbereiche sind bei der Drückjagdplanung obligat und durch die Unfallverhütungsvorschriften verbindlich vorgeschrieben. So besagt die VSG 4.4, dass, sofern eine direkte Sichtverbindung zwischen den Schützen nicht gegeben ist, der Jagdleiter diese sicherzustellen hat. Um die Sicherheitsbereiche fehlerfrei zu markieren, müssen zunächst die Stände kartiert werden. Mit der technischen Hilfe wie den Hundeortungsgeräten von Tracker oder Garmin werden die Stände bereits vor Ort im Revier mit dem aktuellen GPS-Standort in der App kartiert. Eine Nummerierung ist ebenfalls in wenigen Sekunden möglich. Die Sicherheitsbereiche wurden früher, sofern überhaupt vorhanden, zumeist grob mit Augenmaß in Richtung eventuell gefährdeter Nachbarstände oder anderer Gefahrenbereiche mit Signierfarbe markiert. In der Praxis weicht die tatsächliche Richtung nur allzu oft von der vermuteten ab.
GPS gestützte Standkartierung und Sicherheitsbereiche einer Drückjagd
Ein besonderes Gefahrenpotenzial, das jedoch kaum jemand registriert. Zumindest, solange nichts passiert. Als Jagdleiter trage ich diese Verantwortung nicht und habe früh angefangen, die GPS genaue Kartierung der Stände für die Markierung zu nutzen. So können die Nachbarstände mit dem Handy oder Ortungsgerät vom Standort des Nutzers aus auf den Meter genau angepeilt werden. So werden sämtliche Drückjagdstände schnell und exakt zueinander ausgemessen und die jeweiligen Sicherheitsbereiche markiert. Für die Markierung wird forstliche Signierfarbe in Neonfarben genutzt. In der Revierpraxis hat es sich als sinnvoll erwiesen, ein großes, gut sichtbares Ausrufezeichen in exakter Richtung zum Nachbarstand aufzusprühen. Rechts und links davon werden Bäume ebenfalls mit Ausrufezeichen und zusätzlichen einem Pfeil in Richtung Mitte markiert. So ist jene Zone klar erkenntlich, in die der Jäger nicht hineinschießen darf. Wenn ein Drückjagdbock umgestellt wird, werden solche Markierungen mit der Drahtbürste, am einfachsten am Akkuschrauber, vorsichtig wieder entfernt.

Sicherheit geht vor Jagderfolg der Drückjagd!

Der immerwährende Grundsatz! Die Drückjagd soll höchst erfolgreich sein. Schließlich ist nahezu den Rest des Jahres im Vorfeld eine Menge Aufwand nötig. Stände bauen, einrichten, Treiber und Hundeführer einladen, alles Dinge, die eine Menge Zeit kosten. Darüber hinaus erfordert ein gutes Drückjagdergebnis auch vor der Drückjagd eine Menge Zurückhaltung und Jagdruhe. Doch bei allem gewünschten Jagderfolg spielt die übergeordnete Sicherheit eine allgegenwärtige Rolle. In allen Punkten bei der Vorarbeit ist die VSG für Gesellschaftsjagden in die Praxisumsetzung der Drückjagd zu transferieren. Rettungspunkte, Verkehrssicherungspflicht, klare Einweisungen und Ansagen sind ein Muss.
Jagdruhe vor der Drückjagd
Die Ruhe im Revier ist insbesondere vor der Drückjagd von entscheidender Bedeutung. Wird in den etwa drei Monaten vor der Drückjagd noch intensiv gejagt, so wirkt sich dies negativ auf die Jagdstrecke aus. Durch entsprechend viel Ruhe im Revier, insbesondere in den letzten drei Monaten vor der Drückjagd, gewinnt das Wild Ruhe und Vertrauen. Dieses Vertrauen, kombiniert mit einer kleinen Kirrung, sorgt dafür, dass das Wild auch am Drückjagdtag in den vermuteten Einständen liegt. Die Ansitzeinrichtungen nahe der potenziellen Einstandsbereiche müssen zwingend, lange vor der Drückjagd fertig gestellt sein.

Der Zeitplan vor der Drückjagd muss passen

Wird an den Ansitzeinrichtungen nahe den Einständen noch in der Woche vor der Drückjagd gearbeitet, repariert, freigeschnitten oder geastet, so führt das höchst wahrscheinlich dazu, dass das Wild genau diese Einstände meidet. Bereits bei der sommerlichen Ansitzjagd oder der Rehbockjagd können Reparatur- und Arbeitspläne für die Drückjagdvorbereitung erstellt werden.
Dichte Einstände, die ohnehin ein gutes Refugium für das Wild bieten, werden vor der Jagd komplett in Ruhe gelassen. Eine kleine Kirrung im Zentrum, die regelmäßig beschickt wird, kann insbesondere die Sauen beschäftigen und der Drückjagd zu einem höheren Erfolg verhelfen. Der absolute Verzicht auf die Einzeljagd in der Zeit vor der Drückjagd ist ein elementarer Bestandteil und ein sehr wichtiges und doch einfaches Werkzeug für den Revierinhaber.
Die Drückjagdeinladung
Die Drückjagd-Einladung gilt für den Jagdtag als schriftlicher, unentgeltlicher Jagderlaubnisschein. Dementsprechend ist sie bei der Jagd nebst Jagdschein und Waffenbesitzkarte mitzuführen. Die Drückjagd-Einladung sollte sich auf die notwendigen Daten beschränken, damit sie auch komplett gelesen und verstanden wird. Sie enthält das Datum des Jagdtages sowie die Uhrzeit und den Treffpunkt, an dem sich alle Beteiligten treffen. Weiterhin kann sie bereits die Freigabe enthalten, um die entsprechenden Waffen auszuwählen. Darüber hinaus können der Ort des Schüsseltreibens sowie die Kleiderordnung hinterlegt werden, damit die Jagdgäste auch die Anreise hierzu entsprechend mit passender Bekleidung planen können. Darüber hinaus wird auf die Voraussetzungen wie das Mitführen des gültigen Jagdscheins, der Jagdeinladung und des gültigen Schießnachweises hingewiesen. Zudem enthält die Drückjagd-Einladung ein festes Datum, zu dem eine Zu- oder Absage zu erfolgen hat. Nur so kann die Jagd auch entsprechend geplant und durchgeführt werden.

Tierarzt und Tierklinik bei der Drückjagd frühzeitig einplanen

Es ist Aufgabe des Jagdleiters, sämtliche Eventualitäten und Unfälle bereits im Vorfeld bestmöglich abzuschätzen und Vorkehrungen zu treffen. Im Treiben sollte mindestens ein Tierarzt sein. Dieser kann mit Notfallequipment wegnah mit treiben oder als Schütze mit jagen. Dann jedoch an einem zentralen, gut erreichbaren Stand. Im Notfall kann der Tierarzt kleine Versorgungen an seinem Fahrzeug durchführen oder schwer geschlagene Hunde zumindest stabilisieren.
Schnelle Notfallversorgung während der Drückjagd
So ist für geschlagene Hunde bei der Drückjagd eine optimale Rettungskette sichergestellt. Die Koordination von Tierarzt/ Hundeführer und zbV (dazu später mehr) läuft über die Jagdleitung. Der Führer des geschlagenen Hundes informiert den Jagdleiter oder bei großen Jagden einen speziell hierfür beauftragten. Dieser koordiniert/ organisiert dann zbV, Tierarzt und Hund zusammen.

Telefonnummernlisten, Rettungspunkte, Schlüsselrollen und Uhrzeiten einer Drückjagd

Alle an der Drückjagd beteiligten bekommen im Sinne der Sicherheit eine schriftliche, auf ihre Situation/ Position zugeschnittene Einweisung. Auf allen Einweisungen finden sich die zeitlichen Abläufe der Drückjagd, ebenso die Freigaben. Darüber hinaus wichtige Telefonnummern: Jagdleiter, Alle Ansteller, Angaben zu nahe gelegenen Rettungspunkten. Die Telefonnummern von Tierkliniken und dem Tierarzt im Treiben sowie die Telefonnummer des zbV.
Anschuss- und Standkarten für die Drückjagdgäste
Zusätzlich bekommen Schützen noch die Namen und Telefonnummern der Schützen mit Standnummern auf einer Drückjagdkarte. Achtung, hier gilt die Einhaltung der DSGVO. Treiber und Hundeführer bekommen zusätzlich Telefonnummern und Namen der Treiberführer sowie der Gruppenmitglieder in der Treiberwehr. Keine Romane, alles auf das Wesentliche reduziert. Weiterhin bekommt jede Gruppe spezifische Informationen.

Drückjagd- Funktionsträger bekommen volle Information

Nur die Personen in Schlüsselpositionen einer Drückjagd bekommen alle Telefonnummern. Hierzu zählen: Jagdleiter, Ansteller, Treiberführer, Schilderaufsteller, Bergegruppenführer, Schlachter/ Aufbrechplatz sowie jene, die die Strecke legen. Nur bei diesen Funktionsgruppen herrschen Knotenpunkte der Informationskette. Andernfalls kommt schnell Chaos auf, wenn mal ein Schütze meint, es sei noch Wild in der Dickung und die Treiber müssen noch einmal da rein, oder wenn Schützen ohne Ortskenntnis den Bergegruppen erklärt, wo noch Wild einzusammeln ist. All solche Informationen laufen so stets über Funktionsträger oder den Jagdleiter selbst, der dann individuell die Informationen verarbeitet und gezielt weitergibt. Bei großen Jagden kann zu diesem Zweck ein Koordinator eingesetzt werden.
Nachsuchegespanne bei der Drückjagd
Bei jeder Drückjagd kann es zu Nachsuchen kommen. Diese werden schnell und tierschutzkonform entsprechend ihrer Dringlichkeit mit dem richtigen Vorgehen abgearbeitet. Hierzu werden im Vorfeld ausreichend anerkannte Nachsuchengespanne zur Drückjagd eingeladen. Ein anerkanntes Nachsuchegespann wird je bis zu 8 Schützen und je nach zu erwartender Strecke gerechnet. Die Nachsuchengespanne sollten zwingend anerkannt sein, um rechtlich einwandfreie Nachsuchen auch im Rahmen der Wildfolge in fremde Reviere und über eventuell weite Strecken sicher zu stellen. Es reicht, wenn die Nachsucheführer in Rufbereitschaft sind, oder zum Ende des Drückjagdtreibens vor Ort sind. Nachsucheführer werden möglichst von einem Helfer, insbesondere bei wehrhaftem Wild begleitet. Der jeweilige Ansteller ist hierfür ortskundig und kann den Hundeführer einweisen. Erstehilfematerial ist im Pkw vorzuhalten. Das Mindestmaß hierfür ist der Kfz-Verbandkasten. Weiterhin bekommt der Nachsucheführer eine vollständige Stand- und Revierkarte.

Die Riegeljagd

Riegeljagd ist eine Art Drückjagd im Gebirge, zumeist auf Rotwild, aber auch auf Gamswild Hierbei werden bekannte Flucht- und oder Friedwechsel des Wildes mit Schützen abgestellt. Nur wenige Treiber, oft ohne Hunde, rühren dann das Wild leicht an. Durch die geringe Beunruhigung kommt das Wild den Schützen bei der Riegeljagd zumeist vertrauter als bei der Drückjagd auf Schwarzwild mit vielen Hunden und Treibern. Die Riegeljagd nutzt das steile, schwere Gelände mit wenigen, jedoch bekannten Fluchtwechseln in idealer Weise. Aufgrund des geografischen, aber auch Schwerpunktmäßigen Unterschiedes wird sie im Kontext der Drückjagd hier nicht weiter behandelt.
Der perfekte Drückjagdbock: Modell v. Fürstenberg
Drückjagdböcke sind als erhöhte Ansitzeinrichtungen für Drückjagden deutschlandweit nicht mehr wegzudenken. Hoch, niedrig, groß, klein aus Holz oder anderen Materialien, teuer oder billig sowie von hoher und langlebiger Qualität, aber auch von minderer Fertigungsqualität. Die Auswahl ist riesig. Die meisten Drückjagdböcke aus dem Handel entsprechen nicht meinen Ansprüchen des professionell geführten Jagdbetriebes- sicher gute, schnelle und auch günstige Lösungen, aber es ist nicht mein handwerklicher Anspruch als Berufsjäger, Fertigmodelle mit zahlreichen Fehlkonstruktionen zusammen zu basteln, die dann in der Außenwirkung unseren Berufsstand repräsentieren.

Drückjagdböcke aus Berufsjägerhand

Während meiner Zeit als Berufsjäger im Revierdienst hatte ich stets den Anspruch, den perfekten Drückjagdbock zu bauen. Schließlich sind Drückjagdböcke nicht nur Aushängeschild eines Revieres und sicherheitsrelevanter Zugewinn, sondern auch ein Komfortfaktor für den Schützen, um sich voll auf die Drückjagd zu konzentrieren. Maximale Standsicherheit ist hierbei eine der elementaren Grundvoraussetzungen. Die Vorzüge des Drückjagdbockes liegen auf der Hand: Klar definierte Standplätze aller Schützen, ein günstigerer Schusswinkel in den Boden und somit sicherer Kugelfang sowie eine deutlich verbesserte Übersicht und daraus resultierende, mehr mögliche Chancen, die sich positiv auf die Jagdstrecken auswirken können.
Die Anforderungen an den Drückjagdbock
Die Anforderungen geben die Grundlage vor. Ganz nach dem Motto: Form follows function entstand meine Konstruktion aus der Praxis für die Praxis. Mein Anforderungskatalog setzt folgende Mindeststandards: Bodenhöhe ca. 1,9 m, Bodenfläche ca. 1,5 m x 1,5 m mit Sitzbank für bis zu drei Personen, um 90° drehbar, stabil und frontladertransportabel, schnelltrocknend, leichter Windschutz, langlebig, rutschsicherer Boden, hohe Standsicherheit des Drückjagdsitzes ohne Verankerung, stabile, integrierte Leiter, gute Auflagehöhe, um auch im Sitzen sicher zu schießen.

Das Holz als Baumaterial für den Drückjagdstand

Darf nicht nach wenigen Jahren faulen und morsch werden. Das beeinflusst nämlich die Sicherheit in jedem Fall negativ . Weiterhin jedoch auch nicht selten einen hohen Reparatur- und damit Zeit und Kostenaufwand erfordert. Fichtenholz ist nicht sehr beständig gegen Fäulnis und wird aus diesem Grund meist im Kesseldruckverfahren imprägniert, was die Haltbarkeit deutlich erhöht. Aus Kostengründen bestehen die meisten käuflich zu erwerbenden Sitze aus Fichte, bzw. Kesseldruck imprägnierter Fichte oder Kiefer. Deutlich teurer, jedoch auch haltbarer sind hingegen Douglasie und Lärche. Diese Holzarten überdauern viele Jahre, ohne dem Fäulnisprozess zum Opfer zu fallen. Eichenholz stellt sich noch deutlich haltbarer dar, jedoch ist das spezifische Gewicht höher als bei Lärche oder Douglasie und der Preis wesentlich höher. Weiterhin ist es komplizierter zu verarbeiten. Als in der Praxis ideal haben sich Douglasien- und Lärchenholz erwiesen, die beim hier vorgestellten Modell verbaut werden.
Der Fußboden
Besteht sowohl bei gekauften als auch bei den meisten Eigenbauten aus Holz. Zöllige Bohlen reichen bei angepasster Unterspannung aus. Um Reparaturen gering zu halten, wird hier keinesfalls auf Fichte zurückgegriffen. Lärchen oder Douglasienbohlen sind deutlich haltbarer. Auch Eichenbohlen können eingesetzt werden. Jedoch besteht bei jeder Art von Holzboden auf Dauer ein Problem mit der Standsicherheit des Schützen auf der Drückjagd. Mit der Zeit beginnt jede der Holzarten zu verwittern und zu Vermoosen, was die Standfläche bereits bei geringer Feuchtigkeit extrem glatt werden lässt. Ebenso verhält es sich im Winter mit Schnee und Eis. Nicht nur die Strecke wird sich schmälern, auch die Sicherheit leidet enorm und in unverantwortbarer Form unter den wackligen Tanzeinlagen eines Schützen auf glattem Boden.

Ungeeignete Fußbadenvarianten für Drückjagdsitze

Bestreuen mit Split oder Hobelspänen können kurzfristig Abhilfe schaffen. Hobelspäne lassen sich leicht ausbringen, werden aber ebenso leicht wieder weggeweht. Split ist schwer auszubringen, weist aber eine besser rutschhemmende Wirkung auf bei jedoch erhöhter Geräuschentwicklung, insbesondere bei Streugranulat. Hobelspäne und Granulat halten nach der Jagd die Feuchtigkeit auf dem Holz, was wiederum zulasten der Dauerhaftigkeit geht und sollten unbedingt abgefegt werden. Das Aufnageln von Maschendraht hilft bedingt gegen glitschige Moose. Bei Schnee und Eis rutscht die Wirkung hingegen Wort- wörtlich vom Podest. Laub verfängt sich ebenso wie abgeworfene Nadeln zwischen Draht und Holz. So erschweren sie die Reinigung und halten ebenfalls das Wasser am Holz.
Mit Gummi ist nicht sicherer
Das Auslegen von Gummimatten auf die Drückjagdsitze erfordert einen hohen Aufwand, da diese nach der Jagd wieder eingesammelt werden. Gummimatten haben den großen Nachteil, dass sie auf dem feuchten, glitschigen Untergrund in Gänze rutschen. Die hierdurch entstehende Gefahr ist nahezu identisch oder höher wie jene mit der des glatten Holzes und ist als unverantwortlich abzulehnen. Ein Holzboden hat weiterhin immer den Nachteil, dass Holz auf Holz großflächig verschraubt oder vernagelt wird. An diesen großflächigen Auflagepunkten sammelt sich durch die Kapillarwirkung Wasser. Das Wasser hält sich dort und fördert Fäulnis was zu Schwachpunkten führt.

Der beste Boden für den Drückjagdbock

Als absolutes ideal haben sich GFK (Glas- Faser- Kunststoff) Roste erwiesen. Die Einteiligen, im Zuschnitt erhältlichen, leichten Gitterroste bieten bereits bei einer freien Überspannung von einem Meter beste Stabilität. Das Rost wird mit 4- 8 Halteklammern an den Unterspannungen verschraubt. Durch die Eigenheit des Rostes sammelt sich kein Wasser und das Holz kann ideal abtrocknen. Ebenso sind die Auflageflächen sehr gering was der Haltbarkeit zuträglich ist. Der Einbau ist sehr leicht und geht schnell, auch allein, von statten. Durch die wenigen Verschraubungen entstehen weniger Schwachpunkte durch Nägel oder Schrauben in der Unterspannung. Das GFK-Material wird hauptsächlich für Brücken und als frei unterspannter Boden auf Offshore Anlagen, Hafenanlagen und an Bahnanlagen verwendet. Hier liegen Erfahrungswerte der Haltbarkeit von mindestens 19 Jahren vor,- weil es diese Roste erst seit 19 Jahren gibt.
Der haltbarste Boden aus GFK für Drückjagdsitze
Die tatsächliche Haltbarkeit ist weitaus höher. Salzwasser und UV- Strahlung haben den Gitterrosten nichts an. Ideal also um auch als Boden für Drückjagdböcke genutzt zu werden. Selbst wenn der ganze Bock einmal hinüber ist, kann das Gitter einfach entnommen und wieder verbaut werden. Der große Vorteil der Roste ist die DIN- zertifizierte Rutschhemmende Wirkung „R12“, die durch konkave Ränder realisiert wird. Kommt es einmal tatsächlich zu einem folgenschweren Unfall kann der Revierinhaber, dem die Sicherungspflicht obliegt, nachweisen, dass er tatsächlich alles getan hat und das im Sinne der öffentlichen Sicherheit für besondere Bereiche. Kommt es zu einem Rechtsstreit mit der Versicherung ist man mit GFK auf der sicheren Seite. Schnee und Eis fallen einfach durch die Maschen, Eis platzt einfach weg und die Standsicherheit ist auch ohne vorherige Reinigung ideal realisierbar.

Die Holzverbindungen der Drückjagdeinrichtungen

Die Verschraubung mit Schrauben aus gehärtetem Stahl haben sich bewährt. Auch Gerbsäuren aus Eichenholz haben den VA-Schrauben nichts an. Härte und Stabilität, aber auch die Zähigkeit übersteigen deutlich die Werte von verzinkten Schrauben, die zu leicht brechen und als unsicher einzustufen sind. Nägel sind bei etwaigen Reparaturarbeiten ein Problem. Deshalb werden stets gehärtete Schrauben verwendet.
Die Form der Drückjagdansitze
Die Form der Drückjagdsitze ist je nach Geschmack sehr variabel. In der Praxis hat es sich jedoch bewährt, die Front schräg zu stellen, was der Standsicherheit und der Stabilität zuträglich ist. Weiterhin wird auf diese Weise einfach die Leiter integriert, die so auch beim Transport auf Anhänger oder Frontlader nicht extra transportiert werden muss oder Schaden nehmen kann. Die optimale Form für unseren Drückjagdsitz der Extraklasse. Diese Sitze können neben der Drückjagd auch ganzjährig für die Blattjagd sowie die Wildtierfotografie und zur Wildbestätigung genutzt werden. Weiterhin lassen sie sich leicht und wiederholgenau mit einer Schablone bauen.

Die Leiter der Drückjagdböcke

Die Leiter muss der UVV entsprechen. Hiernach müssen die tragfähigen Sprossen gegen Abrutschen nach unten gesichert sein. Einkerbungen am Vierkantholz wären nur Wasserfänger und Fäulnis fördernd. Aus diesem Grunde kommen sie nicht infrage. Das Unterlegen der Sprossen mit einem Winkel ist eine praktikable Möglichkeit, die auch wenig Angriffsfläche für Wasser bietet. Das Einbauen angepasster Zwischenhölzer ist sicher und hat sich in der Praxis bewährt. Denkbar ist auch die Verwendung eines GFK Rostes als Sprosse, hierdurch wäre ein weiterer Zugewinn an Sicherheit und Trockenheit möglich. Die Leiter darf nicht zu flach und nicht zu steil stehen. Bei der integrierten Bauweise folgt der Winkel der Bauform.
Das Sitzbrett
Das Sitzbrett und die Rückenlehne müssen komfortabel sein. Der Drückjagdbock wird stets in Richtung des zu erwartenden Wildes aufgestellt. Diese Richtung kann sich jedoch durch sich verändernden Wind ändern. In diesem Fall ist es gut, das Sitzbrett einfach um 90° drehen zu können, um die Richtung anzupassen, ohne den Sitzkomfort zu missen. Auch die Möglichkeit, das Sitzbrett zu verschieben, hat sich bewährt. Ein in die Mitte des Bockes geschobenes Brett ermöglicht es zwei Personen in entgegengesetzter Richtung Ausschau zu halten. Wichtig: Das Sitzbrett liegt nur lose auf und kann so hochgeklappt werden und niemand hat am Tag der Drückjagd einen nassen Hintern- zumindest nicht vom Sitzbrett.

Die Verkleidung

Die Verkleidung des Drückjagd- Sitzes ist insbesondere im Rotwildrevier obligat. Ebenso beim gut äugenden Damwild kann der unverblendete Sitz den Jäger andernfalls frühzeitig verraten und den Erfolg schmälern. Holzverkleidungen erhöhen das Gewicht und sind Fäulnisförderer. In der Praxis hat sich zum Sicht- und Windschutz sogenanntes Strohschutzflies bewährt. Es hält viele Jahre, ist günstig, winddicht und trocknet schnell, sodass kein Wasser am Holz gehalten wird. Darüber hinaus ist es leicht zu verarbeiten und wiegt nicht viel. Stets werden bei diesem Drückjagdbock mindestens die Vorgaben (VSG, ehem. UVV) der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften eingehalten oder deutlich übertroffen. Der hier gezeigte Drückjagdbock stellt eine Möglichkeit dar, die problemlos in ihrer Größe in Höhe oder Standfläche abgeändert werden kann. Veränderungen müssen jedoch aufgrund der Standsicherheit möglichst proportional ausgeführt werden. Mein Modell ist wie beschrieben für bis zu drei Personen ausgelegt.
Die Bauanleitung für den perfekten Drückjagdbock
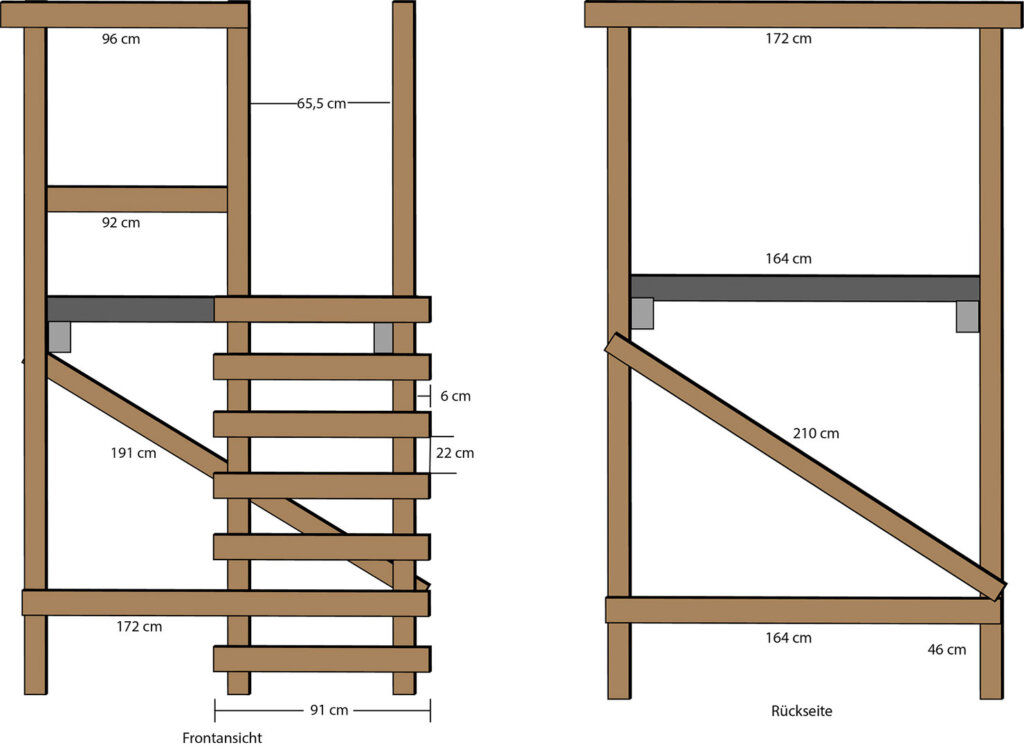
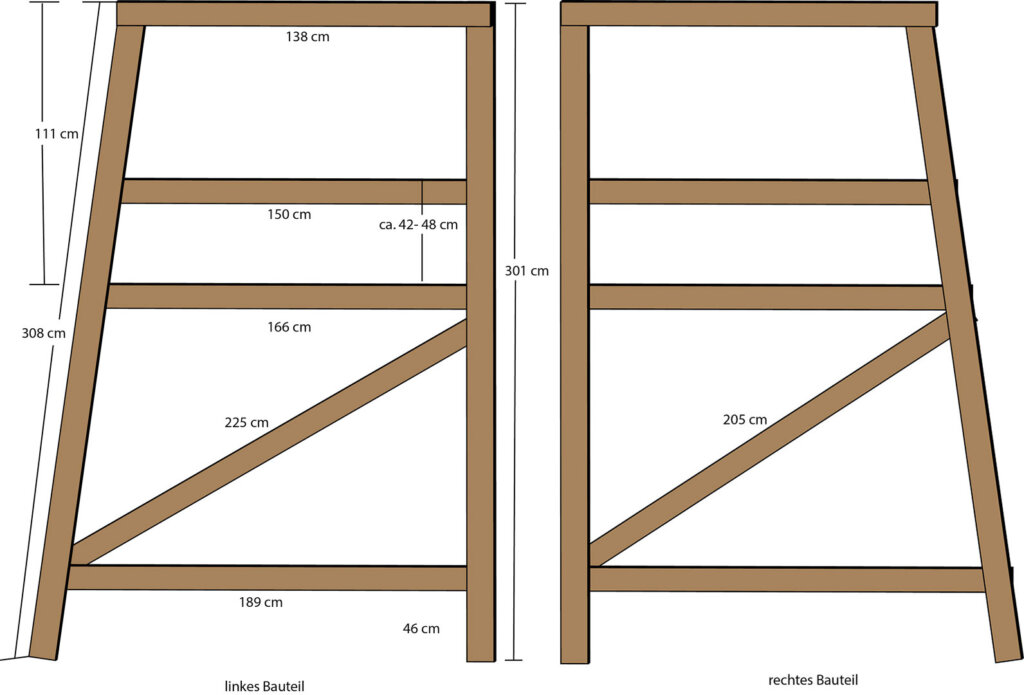
Die Verkehrssicherungspflicht bei Treib- und Drückjagden
Die Verkehrssicherungspflicht bei Treib- und Drückjagden obliegt dem Jagdleiter. Er ist dafür verantwortlich, dass alle Gefahren, die durch die Drückjagd geschaffen werden, abgesichert werden und niemand zu Schaden kommt. Dies betrifft einerseits den normalen erholungssuchenden Verkehr von Wanderern, Mountainbikern oder insbesondere auch Pilzsuchern während der Drückjagdzeit, aber auch den Straßenverkehr. In beiden Fällen sorgt der Jagdleiter für eine bestmögliche Absicherung im Sinne seiner Verkehrssicherungspflicht. Waldwege die Wanderer, Pilzsucher oder auch Reiter nutzen, um in den Wald zu gelangen, werden mit rot-weißem Flatterband, am besten mit der Aufschrift "Achtung! heute Drückjagd", abgesperrt. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Flatterband so hoch hängt, dass man mit dem Geländewagen noch drunter hindurch fahren kann, ohne das Band zu zerreißen. So ist nicht nur sichergestellt, dass alle Jagdteilnehmer ins Revier kommen, ohne das Band zu zerstören, sondern dass auch eine mögliche Rettungskette reibungslos funktioniert, ohne dass die Absperrungen unbrauchbar werden.

Waldwege bei der Drückjagd absichern!
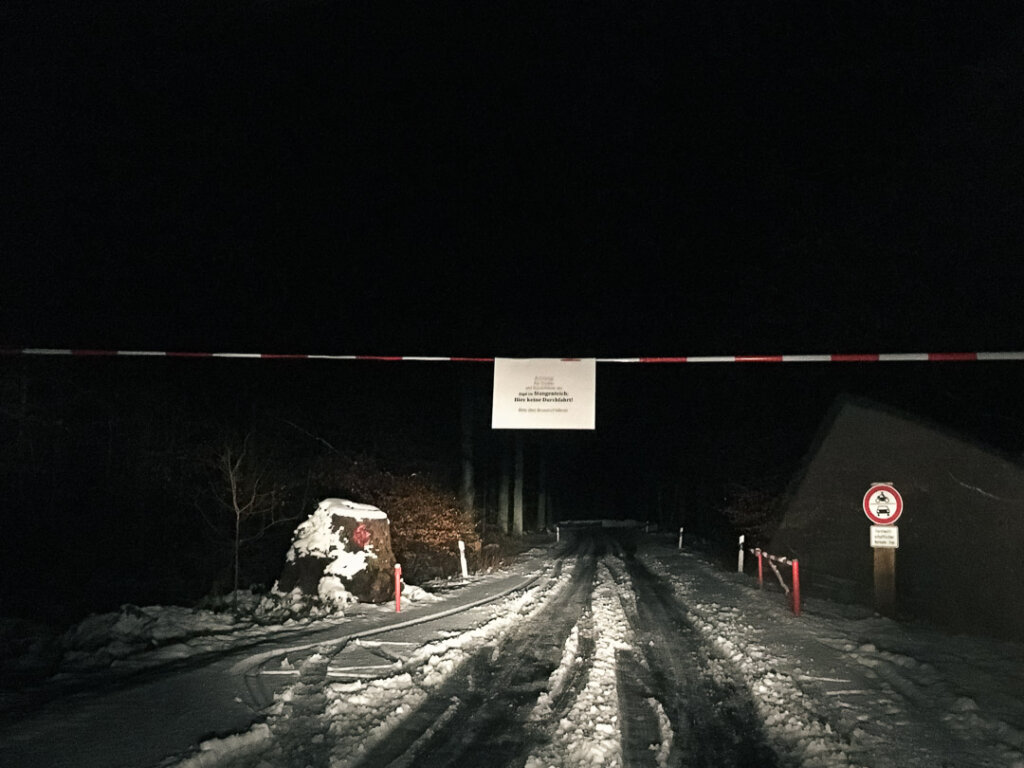
Weiterhin werden sämtliche Waldwege mit Schildern wie einem Ausrufezeichen und Achtung Jagd betreten verboten abgesichert. Das Betreten im rechtlichen Sinne ist nicht direkt verboten, jedoch sorgt der Jagdleiter hiermit dafür, dass allen Waldbesuchern bewusst wird, dass dort eine besondere Gefahr herrscht. Es ist jedoch immer zu beachten, dass der Wald für die Drückjagd nicht im direkten Sinne gesperrt werden kann.
Im Bereich der Verkehrssicherungspflicht in Straßennähe ist das Ganze nicht so einfach. Würde ein Jagdleiter einfach an der Straße Schilder aufstellen oder Personen zum Warnen dort abstellen, so wäre dies ein unerlaubter, ggf. sogar fahrlässiger Eingriff in den fließenden Straßenverkehr, was strafbewehrt ist. Um Straßen während der Drückjagd auf Hochwild abzusichern und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wirkungsvoll herabzusetzen, ist zuvor bei der Straßenverkehrsbehörde ein Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen für Treib- und Drückjagden zu stellen. Dieser Antrag ist je nach Bundesland einmalig oder auf mehrere Jahre gültig.
Geschwindigkeitstunnel für die Verkehrssicherung bei Drückjagden
Hierbei wird mittels einer Karte festgelegt, wo die Treiben stattfinden und welche Straßen wie abgesichert werden sollen und welche Geschwindigkeiten dort normalerweise höchst zulässig sind. Soll beispielsweise eine Bundesstraße, auf der keine Begrenzung herrscht, also 100 km/h gefahren werden darf, für die Drückjagd heruntergeregelt werden, so muss in Abstimmung mit der Behörde zunächst ein Geschwindigkeitstunnel erstellt werden. Hierbei wird die Geschwindigkeit von normal erlaubten 100 km/h auf 70 km/h auf 50 km/h und schließlich auf 30 km/h herabgesetzt. Den Abstand zwischen diesen Beschilderungen, die zusätzlich aufgestellt werden, bestimmt die Behörde, er sollte in der Regel ca. 200 m betragen.

Die richtigen Schilder für die Verkehrssicherung bei der Bewegungsjagd
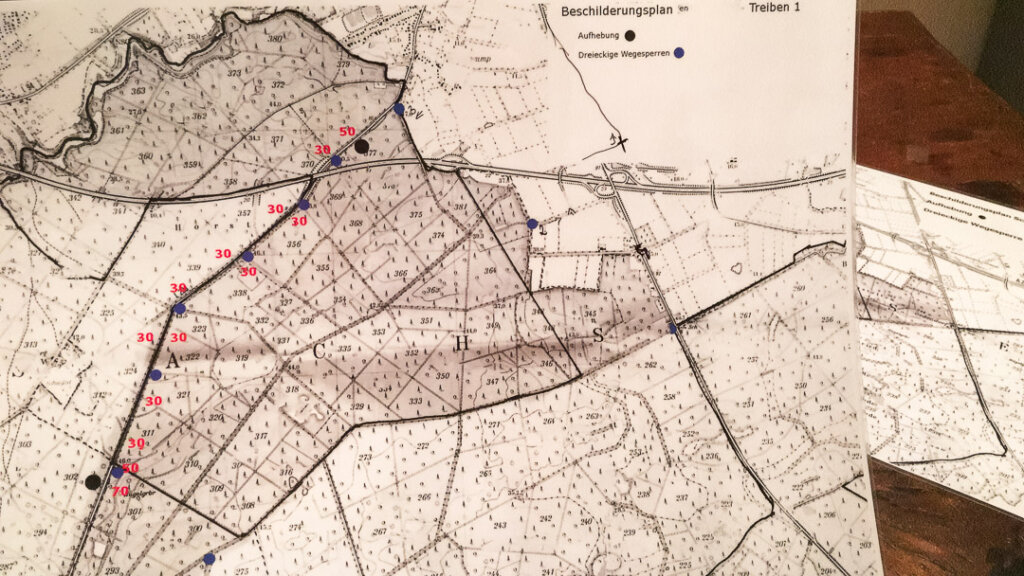
Die Schilder, welche zur Drückjagd aufgestellt werden, müssen dann entsprechend den Regularien der STVO und auch deren Farbgebung und Größenanforderung erfüllen. Hierbei wird dann immer eine Kombination aus der Geschwindigkeitsbegrenzung sowie einem Wildwechselschild, welches auf die besondere Gefahr aufmerksam macht. Weiterhin wird noch ein Treibjagdschild hierbei verwendet. Diese drei offiziellen Schilder zeigen dann jedem, dass es sich hier um eine besondere Gefahr handelt, wegen derer die Geschwindigkeit herabgesetzt ist.
In der Praxis hat es sich als sinnvoll erwiesen, diese Schilder noch mit einer kleinen rot-weißen Fahne zu versehen, um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Am Ende der Gefahrenstelle muss die Geschwindigkeit mit einem Aufhebungsschild wieder aufgehoben werden. Je nach Bundesland ist eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h oder auch nur auf 50 km/h rechtlich möglich. Genaue Auskunft darüber erteilen die Straßenverkehrsbehörden in Abstimmung. Weiterhin hat der Jagdleiter dafür Sorge zu tragen, dass das Wild möglichst immer von Straßen weggetrieben wird.
Verkehrsunfall mit Wild bei der Drückjagd?!
Verkehrsunfall mit Wild bei der Drückjagd?!
Sofern ein Verkehrsunfall mit Wild, insbesondere großem Hochwild, im direkten Zusammenhang mit der Drückjagd steht und der Jagdleiter seiner Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend nachgekommen ist, so handelt es sich hierbei nicht um einen Wildunfall im eigentlichen Sinne, für den die Kaskoversicherung aufkommt. In solchen Fällen würde die Jagdhaftpflichtversicherung des Jagdleiters eintreten. Ist der Jagdleiter seiner Verkehrssicherungspflicht bei der Drückjagd hingegen in vollem Umfang nachgekommen, so scheidet hierdurch die Haftung des Jagdleiters aus und die Kaskoversicherung greift wieder. In allen Fällen gilt bereits bei der Vorplanung jeglichen Verkehr bestmöglich abzusichern.

Straßenbeschilderung bei der Drückjagd – Posten mit Verantwortung!

Bislang wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit in straßendurchzogenen Revieren zumeist für die Drückjagd herabgesetzt. Handelt es sich um mehr als 5 Schilder, übernimmt bestenfalls ein Ortsunkundiger diese Aufgabe. Die zuvor erstellte Beschilderungskarte hilft beim exakten Aufstellen. Was wo aufzustellen ist, ist hierdurch gut ablesbar. Vorausgesetzt, der Aufstellende weiß das Kartenmaterial entsprechend zu lesen. Kurzfristige Änderungen sind jedoch nicht möglich. Ausschließlich mündliche Einweisungen führen zu Chaos und sind strikt zu unterlassen. Durch die Nutzung einer App, wie der Tracker Hundeortung, werden die Standorte sowie die dort zu nutzenden Schilder entweder direkt im Revier oder im Büro in die digitale Karte eingepflegt. Mithilfe der Gruppenfunktion können sämtliche Standorte an die entsprechenden Personenkreise freigegeben und dadurch sichtbar gemacht werden. Sogar im Dunklen kennen auch Ortsfremde hierdurch ihre genaue Position auf einer Straße und können die Beschilderung exakt vornehmen. Insbesondere genaues Kartenlesen ist nicht jedermanns Stärke.
Drückjagd an der Straße- Die Hundearbeit
Wird das Drückjagdtreiben auch im Bereich von Straßen durchgeführt, wird immer von der Straße weg getrieben. Das Treiben ist entsprechend dieser Grundlage anzulegen. In direkter Nähe der Straße werden ausschließlich Treiber eingesetzt, die Hunde bleiben an der Leine. Die Anzahl der Treiber ist gegebenenfalls angepasst an die Einstände zu erhöhen. Es gilt der Grundsatz: So nur viele Treiber wie nötig und so wenig Personen im Treiben wie möglich! Jede Person mehr im Treiben stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. Auch die sogenannten Durchgehschützen, werden auf ein Minimalniveau beschränken und ausschließlich Hundeführer sein. Werden bei der Drückjagd auch Hunde eingesetzt, entscheidet der Jagdleiter, ab wann die Hunde geschnallt werden. Mindestens dreihundert, besser fünfhundert Meter von der Straße sollten es schon sein. Die Hunde, die dann dort geschnallt werden, sollen zuverlässig kurzjagend sein. Kurzjager eignen sich immer in straßennahen Treiben oder in kleinräumigen Treiben, wie beispielsweise auch dem Kreisen und Anrühren von Sauen nach einer Neuen.

Die VSG 4.4: Sicherheit bei der Drückjagd

Der Jagdleiter einer Drückjagd ist nicht nur maßgeblich für die Vorbereitungen und sämtliche Organisation verantwortlich, sondern auch für die Einhaltung der Sicherheitsregeln. In diesem Fall ist es die VSG 4.4 der SVLFG, hinlänglich bekannt als UVV- Unfallverhütungsvorschrift. Im Vorfeld müssen verschiedene Sicherheitskonzepte geplant, eventuell genehmigt und am Jagdtag umgesetzt werden. Nur so können alle an der Jagd Beteiligten sowie alle unbeteiligten maßgeblich vor Schäden bewahrt werden. Für mich gilt immer der Grundsatz, dass jemand, der eine Gefahr schafft, was eine Drückjagd unweigerlich ist, dafür Sorge zu tragen hat, dass durch diese Gefahr niemand zu Schaden kommt. Nicht zuletzt gilt hierdurch nach wie vor der Grundsatz: Sicherheit geht vor Jagderfolg! Auch der Grundsatz: jeder Schütze ist für seinen Schuss verantwortlich, entbindet den Jagdleiter nicht davon, alle Sicherheitsvorkehrungen zu einem gefahrlosen Jagdablauf gewissenhaft durchzuführen.
Besonders gefährdete Personen- Drückjagd und Alkohol
Personen, die aufgrund ihres Alters oder Aufgrund von Krankheiten oder aufgrund von Alkohol und sonstiger berauschender Mittel besonders unfallgefährdet sind, dürfen nicht an der Drückjagd teilnehmen. Persönlich schließe ich diese Personengruppen nicht nur insbesondere als Schützen, sondern auch als Helfer und Treiber vollständig von der Jagd aus. Weiterhin dürfen Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten an Drückjagden teilnehmen. Besondere Gefahren dürfen dann nicht vorkommen. Ob Kinder unter 14 Jahren mitdürfen, hängt auch von ihrer körperlichen Entwicklung und geistigen Reife ab. Ab 14 Jahren dürfen sie, geistige und körperliche Eignung vorausgesetzt, auch allein mit treiben. Dann werden Sie jedoch einem erfahrenen Treiber beigeordnet.

Jugendjagdscheininhaber bei der Drückjagd

Dürfen nicht als Schütze an der Gesellschaftsjagd, also auch nicht an Drückjagden teilnehmen. Mit ihrer Ausbildung und ihrem jagdlichen Wissen sind Sie jedoch prädestiniert, Schlüsselpositionen zu unterstützen. So beispielsweise die Wildbergung oder das Anstellen und die Anschussmarkierung. In allen Bereichen können Jugendjagdscheininhaber so einiges an Erfahrung gewinnen.
Schlechte Sicht am Drückjagdtag
Bei schlechten Witterungs- oder Sichtverhältnissen hat der Jagdleiter die Drückjagd einzustellen. Hierzu zählt neben einbrechender Dunkelheit am frühen Nachmittag im Herbst und Winter insbesondere auch herbstlicher Nebel. Sofern der Jagdleiter die Unversehrtheit aller an der Jagd Beteiligten und Unbeteiligten aufgrund schlechter Sichtverhältnisse nicht sicherstellen kann, wird die Jagd beendet. Optimal ist in der dunklen Jahreszeit ohnehin nur ein Treiben. Treiben am Nachmittag bis in die Dämmerung hinein bergen ein besonderes Gefahrenrisiko und erschweren zusätzlich die zügige Bergung des Wildes. Auch durch die richtige Einschätzung solcher Umstände obliegt dem Jagdleiter ein hohes Maß an Verantwortung.

Signalkleidung und Hundeschutzwesten

Signalkleidung ist bei der Gesellschaftsjagd obligatorisch vorgeschrieben. Zur deutlichen farblichen Abhebung von der Umgebung eignen sich großflächige Oberbekleidung in Signalfarben wie z.B. Warnwesten. Eine signalfarbene Jagdjacke oder eine orangene/ neongelbe Warnweste sowie das Hutband oder besser eine orangefarbene Baseballcap sind das Mindeste. Ein paar weitere Signalwesten oben um den Drückjagdstand gehängt sorgen für eine erhöhte Sichtbarkeit. Treiber heben sich durch Ihre Signalkleidung deutlich von der Umgebung ab, viele Hersteller bieten hierfür optimal sichtbare und zugleich widerstandsfähige Drückjagdkleidung. Sauenschutzhosen bieten ausreichenden Schutz vor Konfrontationen mit wehrhaften Schwarzborstlern.
Kontrolle der jagdlichen Einrichtungen bei der Drückjagdvorbereitung
Die Drückjagdböcke müssen nicht nur am Drückjagdtag einwandfrei und sicher sein, sondern ganzjährig! Das ganze Jahr über können diese Ansitzeinrichtungen auch für die Einzeljagd oder Sammelansitze genutzt werden. Mindestens einmal jährlich werden die Drückjagdsitze auf Ihre Standsicherheit, Sicherheit und Haltbarkeit überprüft. Hierzu eignet sich ein Kontrollprotokoll, in dem alle Teile aufgeführt sind. So kann auch im Reparaturfall schnell und einfach eine Materialliste erstellt und die Reparatur zielgerichtet angegangen werden. Die Kontrolle erfolgt im Sommer, lange vor der Drückjagd. So bleibt ausrechend Zeit für die notwendigen Reparaturen sowie ein Arbeitsprotokoll über die notwendigen Astungs- und Freischneidearbeiten.

Der Kugelfang bei der Drückjagd

Kugelfang ist ausschließlich gewachsener Boden. Das ungewollte und gefährliche Weiterfliegen abprallender Geschosse soll durch einen steilen Eintrittswinkel in den Kugelfang sichergestellt werden. Sämtliche Eintrittswinkel unter 10° sorgen für signifikant gefährliche Abpraller. Steine, Wasserflächen, Holz/ Bäume und Astwerk sorgen für hohe und gefährliche Abpraller. Der Jagdleiter muss durch geeignete Stände, die das Gelände optimal auch im Hinblick auf den Kugelfang ausnutzen, sicherstellen, dass keine gefährlichen Schüsse ohne geeigneten Kugelfang möglich sind.
So weit kann man bei der Drückjagd Schießen
Je höher der Drückjagdbock, desto steiler der Eintrittswinkel der Geschosse- jedoch sind Drückjagdsitz von extremer Höhe ungeeignet für Schüsse auf Wild in geringer Entfernung. Bodenhöhen von rund 2 m haben sich in der Praxis als guter Kompromiss erwiesen. So sind unter Einhaltung des mindestens 10° Eintrittswinkel Schussentfernungen bis 20 m unter Beachtung der Sicherheit möglich. Je nach ansteigendem Gelände und Relief auch mehr. Dass auf Drückjagden so wenig passiert, liegt möglicherweise in Teilen auch einfach daran, dass Geschosse in Relation zu uns Menschen klein sind und dass der uns umgebende Wald in Relation wiederum sehr groß ist und einfach viel freie Fläche dazwischen ist, die viele Unfälle verhindert. Jeder Schütze muss sich vor Abgabe eines Schusses klarmachen, dass ausschließlich er selbst für seinen Schuss verantwortlich ist!
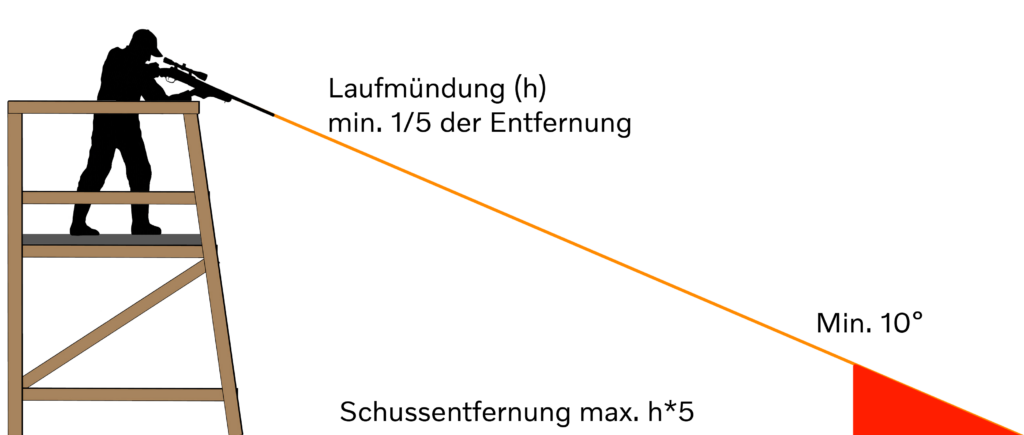
Bei spitzeren Einfallswinkeln dringt das Geschoss nicht in den Boden ein und es kommt zu einem Absetzer (Abpraller). 10° gelten für weichen, steinfreien Boden. Bei Steinen, gefrorenem oder hartem Boden können Geschosse auch bei 10° sowie stumpferen Winkeln gefährlich abprallen.
Die Entfernung zum Ziel darf etwa dem fünffachen der Höhe entsprechen, sodass sich ein 10° Eintrittswinkel ergibt.
Der Durchgehschütze auf der Drückjagd

Eine Jagdeinladung zur Drückjagd flattert ins Haus des Jungjägers. Bereits seit zwei Jahren geht er bei „seinem“ Beständer als Treiber mit und hat viel gelernt. Jetzt ist endlich der erste Jahresjagdschein gelöst und die Drückjagden stehen vor der Tür. Noch bekommt er keinen festen Schützenstand zugewiesen, sondern ist in diesem Jahr als Treiber-/ Durchgehschütze auf der Drückjagd mit dabei. Einen Keiler hat er frei! Die Freude ist gigantisch. Wie die meisten anderen auch, wird er im Treiben eine Waffe führen. Er hofft, genauso wie die anderen Durchgehschützen in vergangenen Jahren Beute machen zu können. Es ist ein gutes Sauen Jahr und mitten im Treiben, in den Dickungen, nah am Wild, voll im Geschehen wird sich sicher eine Chance bieten. Eine solche oder ähnliche Situation ist Land auf, Land ab sehr häufig. Leider!
Unbekanntes Drückjagdgelände- Hohe Gefahr
Ein Treiber kennt meist die geografischen Gegebenheiten in einem Revier nicht. Ebenso fehlt ihm im Treiben der genaue Überblick, wo Standschützen stehen oder eventuell eine andere Treiberwehr zu Werke geht. Oft fehlt selbst der Kontakt innerhalb einer Treiberwehr, sodass auch die Position eines Nebenmannes unbekannt sein kann.
Jagd der Treiber nun aktiv mit und will zur Strecke beitragen, ist dies nicht nur eine klare Zuwiderhandlung gemäß den Unfallverhütungsvorschriften, sondern auch ein untragbares und unkalkulierbares Sicherheitsrisiko für alle an der Drückjagd Beteiligten. Es ist vollkommen untersagt, gesundes Wild zu erlegen!
Ein ordnungsbewusster Jagdleiter kann und wird dieses Risiko nicht tragen!

Wofür darf die Waffe mit ins Drückjagdtreiben

Im Treiben auf Schalenwild- Drückjagden dürfen nur entladene Waffen (Patronenlager leer) mitgeführt werden. Die ausnahmsweise Benutzung der Waffe im Treiben erstreckt sich auf den Eigenschutz, den Fangschuss sowie den Schuss auf von Hunden gestelltes Wild.
Eigenschutz ist ein sehr seltener Fall, dem meist durch ein Ausweichen entgangen werden kann. Im Falle von sichtbar krankem Wild, darf unter Berücksichtigung der Sicherheit sowie bei vorhandenem Kugelfang der Fangschuss angetragen werden. Fangschüsse im Treiben sind auf absolute Nahdistanz beschränkt! Oft ist der Fangschuss leider aufgrund der Situation, der Positionen der anderen Personen, der Entfernung zum kranken Stück, dem fehlenden Kugelfang oder dem zu flachen Schusswinkel unverantwortlich und das Stück wird später nachgesucht. Hierzu werden Pirschzeichen markiert.
Die Hunde stellen Wild auf der Drückjagd!
Der Schuss auf von Hunden gestelltes Wild ist meist nicht ohne weiteres möglich, da Hunde in dem Fall nah am Wild arbeiten, sich vor oder hinter diesem aufhalten oder es, je nach Schärfe auch halten, vor allem wenn dieses bereits krank ist. Da hier besondere Umsicht von Nöten ist, kommt meist kein Schuss infrage, sondern das Wild ist in diesem Fall mit der blanken Waffe abzufangen. Den etwaigen Fangschuss sollte in dem Fall einzig der Hundeführer selbst mit der Langwaffe antragen, sofern dies möglich ist. Wenn es zu Situationen kommt, in denen Wild abgefangen werden muss, darf dies nur durch den Inhaber eines gültigen Jagdscheines geschehen, da das Töten von Wild per Gesetz als Jagdausübung gilt.
Gegen die Benutzung einer Waffe im Treiben zu ausschließlich den vorgenannten Zwecken ist nichts einzuwenden, besonders wenn ein einzelner Hund krankes oder wehrhaftes Wild stellt, ist oft der Fangschuss das Mittel der Wahl.

Strecke machen die Drückjagdschützen!

Die Anzahl der Waffen im Treiben bei der Drückjagd wird auf das Minimum reduziert. Waffenträger sind erfahrene Hunde- sowie Gruppenführer. Kurzwaffen schließe ich bei der Drückjagd aus mehrerlei Gründen kategorisch aus.
Die Strecke wird nicht im Treiben gemacht! Leider ist dies für viele noch nicht normal und auch sehr junge Jäger treiben bereits bewaffnet mit, um mit der Brennecke aus der Flinte sich bietende Chancen verwirklichen zu können.
Als Rechtfertigung wird oft angeführt, dass ein ordentliches Vorgehen nur bei großen Drückjagden möglich sei und wenn man sich kenne und kleinere Gesellschaftsjagden ausrichte, bei denen das“ immer so gemacht wurde“, solche Verbote nicht nötig wären. Das ist grundlegend falsch!
Gerade jüngere Jäger können ohne Waffen bei der Bewegungsjagd den Standschützen das Wild zutreiben. Später werden Sie in den Genuss eines Standes kommen. Auch kann ein Wechsel stattfinden, bei dem sich alle sich abwechseln, einmal Treiber, einmal Standschütze.
Durchgehschütze mit Drückjagdstand
Eine Hybridmethode stellt der Durchgehschütze mit entladener Waffe dar, der einen definierten Teil des Triebes als Treiber mitläuft, dann bei Ankunft seinen Stand einnimmt, auf dem er für den Rest der Drückjagd verbleibt und der festgelegte Sicherheitsbereiche aufweist. Von hier aus kann er dann als Standschütze gefahrlos jagen.
Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (SvLFG) gibt mit ihren VSG 4.4 „Jagd“ die Unfallverhütungsvorschriften vor, welche die Sicherheit im jagdlichen Bereich, Speziell auch auf Gesellschaftsjagden, wozu Drückjagden zählen regeln.
Zuwiderhandlungen können für Jagdleiter zu Bußgeld, Strafverfahren sowie zivilrechtlichen Haftung führen, da die Unfallverhütungsvorschriften von Gerichten in Verfahrensfällen als Grundlage herangezogen werden. Auch wenn es sich nicht um Gesetze oder Verordnungen handelt. Insbesondere die Drückjagd steht stets im Fokus der Öffentlichkeit. Jagdunfälle landen sofort im Internet sowie den Zeitungen. Jeder Jagdunfall durch Missachtung dieser einfachen Regeln ist einer zu viel! Das Streckemachen obliegt nie den Treibern.

Die Treiben der Bewegungsjagd

Anhand einer Drückjagdkarte und einer Geländebegehung wurden die unterschiedlichen Treibergruppen eingewiesen. Ortskundige Treiberführer führen dann die Treiberwehr wie zuvor festgelegt. Ortsfremde finden sich in unbekanntem Gelände meist nicht ausreichend zurecht. Kartenmaterial hilft bei fehlendem Orientierungssinn nur bedingt, da der Hundeführer seine vorherige Position in der Treiberwehr nach dem Angehen eines möglichen Standlautes gar nicht mehr wiederfindet.
Die Errungenschaft der Technik bietet heute viele Vorteile. Im Vorfeld werden einzelnen Treiben für die verschiedenen Gruppen in der Trackerapp festgelegt und farblich gekennzeichnet. Start und Endpunkt der Treiben werden ebenso hinterlegt wie die Richtung des Treibens oder Haltepunkte und Einstandskomplexe. Mittels der Gruppenfreigabe erhalten jeweils nur jene Personen die Daten, welche diese auch benötigen. Sogar Ortsunkundige sind hierdurch in der Lage, das Treiben entsprechend der Planung im unbekannten Geländedurchzuführen und zu leiten. Die aktuelle, eigene Position ist stets sichtbar und hilft bei der Orientierung.
Pflichten des Jagdgastes auf der Drückjagd
Der Jagdgast hat Pflichten. Zunächst sei hier gesagt, dass er sich schnellstmöglich, mindestens jedoch fristgerecht, für eine Drückjagdeinladung bedankt und ebenso schnell zu- oder absagt. Es ist eine Unsitte, eine Zu- oder Absage später für eine bessere Jagd noch zu abzuändern. Einmal zugesagt bleibt zugesagt! Abgesagt bleibt abgesagt! Sofern gewünscht, wird der gültige Jagdschein im Vorfeld zugesandt. Unabhängig hiervon wird der gültige Jagdschein nebst Personalausweis / Waffenbesitzkarte am Jagdtag mitgeführt. Er wird unaufgefordert bei der Kontrolle vorgezeigt. Zusätzlich wird die Belehrung der Unfallverhütungsvorschriften mittels Unterschrift anerkannt. Ein ruhiges Verhalten bei sämtlichen Ansprachen ist selbstverständlich. Weiterhin jagt der Jagdgast stets entsprechend der Drückjagdvorgaben und Freigaben des Jagdleiters und hält sich an UVV und besondere Verhaltensregeln für den Drückjagdtag wie beispielsweise Schussdistanzen und die Beschränkung auf max. 2 unklare Anschüsse, nach denen nicht mehr weiter geschossen werden darf. Die Grundpflicht des Jagdgastes für eine erfolgreiche Jagd: Üben, insbesondere auf den laufenden Keiler.

Sinnvolle Drückjagdausrüstung

Herbst. Die Zeit der Drückjagden des Jahres ist angebrochen. Für viele Jäger eine der spannendsten Zeiten im Jagdjahr, auf die wir sehnlich hin fiebern. Nicht unwichtig ist somit auch die richtige Ausrüstung, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Jagd. Zu viel Ausrüstung geht jedoch sehr zu Lasten der Fokussierung. Daher bin ich ein Freund von sehr wenig, aber sehr hochwertiger Ausrüstung, um jede drückjagdsituation sicher zu beherrschen. Je puristischer die Ausrüstung, desto weniger Ablenkung vom Wesentlichen!
Das Gewehr für die Drückjagd
Das essenzielle Werkzeug des Jägers: Die richtige Drückjagdwaffe. Das Kaliber sollte für die Drückjagd mindestens hochwildtauglich und trotzdem gut beherrschbar sein. Niemandem nützt eine 9,3x64, die alle Reserven wirklich benötigt, weil Schüsse so miserabel sind. Lieber ein etwas kleineres, dafür sehr gut beherrschbares Drückjagdkaliber. So entscheidet doch in erster Linie der Treffersitz über die sichere und schnelle Tötungswirkung. Das Geschoss sollte ausschließlich ein Deformationsgeschoss sein. So werden keine Splitter zu unkontrollierbaren Sekundär- Projektilen, die eine unkalkulierbare Gefahr mit sich bringen. Deformationsgeschosse weisen in der Regel eine gute Tötungswirkung verbunden mit einer guten Richtungsstabilität im Wildkörper und danach auf. Gerade was die Sicherheit der arbeitenden Hunde angeht, ist dies einer der wichtigsten Punkte, die für Deformationsgeschosse auf der Drückjagd sprechen. Die Waffe muss vom Schützen in jeder Situation voll beherrscht werden. Eine extra Drückjagdwaffe zu führen, die in der Bedienung anders ist als die Waffe für das restliche Jahr, ist mehr als unsinnig!

Die richtige Zieloptik für die Drückjagd

Der Schütze muss mit der Waffe schnell in den Anschlag kommen und möglichst direkt zentriert in das Zielfernrohr blicken können. Hierzu sind individuelle Schäftungen mit angepasster Schaftrückenerhöhung das Mittel der Wahl. Die Zieloptik muss ein Maximum an Sehfeld bieten, hierdurch erhält der Schütze die bestmögliche Übersicht und kann auch schwierige Drückjagdsituationen schnell überblicken und so die volle Kontrolle er- und behalten. Vergrößerungsbereiche von 1,7- 13,3- fach in einem variablen Zielfernrohr gepaart mit Objektivdurchmessern von 42 mm sind ideal. Mit solchen Gläsern kann auf der Bewegungsjagd in idealer Weise agiert werden. Alle Situationen, von der schmalen Schneise mit geringer Schussentfernung im Wald, bis hin zu weiten Schüssen auf stehendes Wild in der offenen Landschaft sind jederzeit beherrschbar. Der Tages- Leuchtpunkt ist obligat. Mein persönlicher Favorit für mittlerweile alle Situationen, auch jene außerhalb der Drückjagd: Das Swarovski z8i 1,7-13,3x42 P SR mit Flexchange Absehen.
Fernglas für den Drückjagdeinsatz
Ein Fernglas gehört zur Grundausstattung des Jägers. Selbstredend wird das meiste Wild auf der Drückjagd direkt vor dem Schuss durch das Zielfernrohr angesprochen. Je nach Situation- Entfernung, Übersicht oder auch, weil sich eventuell Treiber oder Häuser in Richtung des Wildes befinden, verbietet sich das Ansprechen durch das auf der Waffe montierte Zielfernrohr. Zum Ansprechen ist in solchen Situationen ein Fernglas, möglichst mit integriertem Entfernungsmesser, unersetzlich. In der weiten, offenen Landschaft gibt der Entfernungsmesser Sicherheit über die Schussentfernungen. Optimal für die Drückjagd sind leichte Tages- Pirschgläser mit Objektivdurchmessern unter 42 mm und Vergrößerungen von max. 10-fach. Mein Favorit für alles: Swarovski El Range 8x42

Gehörschutz bei der Drückjagd

Der Schalldämpfer ist glücklicherweise mittlerweile nahezu nicht mehr wegzudenken, schützt er doch effektiv das Gehör und lässt uns auch Drückjagdsituationen viel besser beherrschen. Da das lästige Pfeifen, der Tinnitus, der uns nach dem Schuss akustisch aus der Situation reißt, entfällt. Der aktive Gehörschutz, MSA Sordin PRO X- Testsieger meines Tests für das Jägermagazin, leistet hier darüber hinaus beste Dienste. Er schützt nicht nur effektiv und besonders ergonomisch das Gehör, sondern verstärkt die Umgebungsgeräusche signifikant. Hierdurch lässt sich leise annäherndes Wild besonders früh entdecken. Die Geräte sind wasserdicht und wärmen zusätzlich bei kaltem Wetter die Ohren und schützen vor Zugluft. Eine sehr sinnvolle technische Ergänzung der Drückjagdausrüstung.
Messer für den Schützen
Das Messer ist essenzieller Ausrüstungsgegenstand des Drückjagdjägers. Der Standschütze benötigt kein Abfangmesser. ein leichtes Universalmesser reicht aus. Hiermit kann Wild auch bei der Drückjagd aufgebrochen- und leichtes Wild im Notfall abgefangen werden. Bewährt haben sich hierzu Messer des schwedischen Herstellers Mora. Klein, leicht, günstig, schnitthaltig, gut sichtbar und von guter Verarbeitung mit durchgängigem Erl bestehen sie den Drückjagdallteg. Wird nach der Gesellschaftsjagd von den Schützen selbst aufgebrochen, erleichtert ein zusätzliches Gekrösemesser die rote Arbeit.

Erste Hilfematerial für den Drückjagdeinsatz

Um im Notfall auf der Drückjagd schnell erste Hilfe leisten zu können, sei es bei Hund oder Mensch, ist stets ein kleines, sinnvoll gepacktes Verbandpäckchen mitzuführen. Wichtiger als eine Üppige Ausstattung, ist das Beherrschen der mitgeführten Verbandteile. Ergänzt werden sollte das forst- oder jagdliche Erste Hilfe- Paket um Klarsichtfolie für Verletzungen des Brustraumes sowie Desinfektionsmittel und Pflaster für kleine Verletzungen sowie einem Tourniquet.
Zusätzliche Latexhandschuhe schützen beim Aufbrechen vor Zoonosen und halten die Hände sauber.
Powerbank
Ist der Tag lang oder kalt, lässt der Akku des Mobiltelefons schnell nach. Auch wenn gerade dieses ablenkende Gerät möglichst nicht genutzt werden sollte, so ist es doch einer der wichtigsten Gegenstände, wenn es im Notfall darum geht, schnell Hilfe zu einem bestimmten Punkt im Wald zu holen. Um so schlimmer, wenn dann der Akku versiegt. Moderne Powerbanks bieten dem Handy mehrere volle Akkus, einige besitzen sogar einen integrierten Handwärmer.

Sitzkissen& Drückjagdrucksack

Im Sinne der Konzentration und der Gesundheit sollte auch in jungen Jahren stets ein Sitzkissen auf der Drückjagd benutzt werden. Ob dicht aus Filz oder leicht und aufblasbar ist, ist dabei Geschmackssache. Um Sitzkissen, Fernglas, eine Ersatzjacke, die auch gern genutzt werden kann, um die Knie warm zu halten, sowie die anderen notwendigen Dinge wie genügend Munition gut transportieren zu können, bietet der Markt viele geeignete Drückjagdrucksäcke an. Persönlicher Favorit ist der Vorn Deer mit einem Volumen von 42 Litern. Durch die integrierte Waffenhalterung lässt das Gewehr auch ohne störenden Riemen bequem und geschützt zum Drückjagdstand tragen. Alle notwendigen Dinge finden darin Platz, er lässt sich auch voll beladen angenehm tragen und bietet eine gute Auswahl an leicht zugänglichen Taschen. Für Leute mit dem Sinn nach einem leichteren Rucksack bietet Vorn den Lynx an.
Drückjagdkleidung: Zwiebelschalenprinbzip
Die Drückjagdbekleidung ist einer der wichtigsten Bestandteile der Drückjagdausrüstung. Lässt Sie Kälte und Nässe durch, ist der Jagderfolg schnell dahin, ebenso die Gesundheit. Je wohler wir uns bei der Jagd fühlen, desto fokussierter sind wir auf das Wesentliche.
Je dünner die Bekleidung, desto besser die Bewegungsfreiheit, genau aus diesem Grund wird möglichst auf dicke Winterjacken verzichtet.
Ideal ist das Zwiebelschalenprinzip, wenn nötig und möglich ergänzt um beheizte Kleidung.
Die unterste Schicht besteht bei mir aus einem Svala langarm Funktionsshirt. Es besitzt Luftkammern, isoliert in optimaler Art und Weise und leitet die Feuchtigkeit schnell vom Körper weg. Hierdurch wird weiterer Auskühlung auch nach körperlicher Anstrengung entgegengewirkt.

Drückjagdkleidung: Beheizte Kleidung auch für hart gesottene

Darüber getragen leistet bei kühlen Temperaturen eine Heizweste wie die Lenz Heizweste 2.0 beste Dienste. Sie ist absolut körpernah geschnitten und sehr dünn. Die Wärmezonen sind genau dort, wo sie sein müssen, im Nierenbereich und oben an den Schultern. Die Bedienung erfolgt komfortabel und zuverlässig per App. So entfällt während der Drückjagd das lästige Suchen nach dem Schalter. Die Heizstufen lassen sich gut regulieren und die Körperwärme genau dort halten, wo Sie benötigt wird- ganz nah an der Haut. Weiterer positiver Effekt durch die Trageweise direkt über der untersten Schicht ist der Einsatz geringerer Heizstufen und somit längerer Haltbarkeit der Akkus. Heizjacken die als eine der oberen Schichten getragen werden leisten nicht den gleichen Effekt wie in einer unteren Schicht.
Kleidung für die Drückjagd: Die Oberschichten
Als dritte Schicht über der Heizweste bietet das Aclima double Wool Polo, das dünnste und wärmste Woll- Polo auf dem Markt. Mit hohem Kragen hat es den besten Wärmerückhalt gepaart mit bester Feuchtigkeitsableitung. Der hohe Kragen bietet bis zum Kinn einen stets warmen Hals. Der ständige Begleiter im Winter. Wolle hat zusätzlich den Vorteil, dass nicht nur der Körper trocken und warm gehalten wird, sondern auch, dass kein Schweißgeruch entsteht. Über dem Polo kann als vierte Schicht die Brynje Antarctic Jacke beste Dienste leisten. Mit dieser dünnen und warmen Kombination ist der Jäger bis zum Gefrierpunkt absolut beweglich und hervorragend gerüstet. Bei kälterem Wetter oder Regen wird eine zusätzliche Schicht genutzt. Eine warme Jacke von Carinthia oder eine Sitka Daunenjacke leisten beste Dienste! Auch ein Windstopper Troyer Kann reichen. Auf der Drückjagd wird die beschriebene Variante mindestens mit einer Warnweste, besser noch mit einer leisen, wind- und regendichten Warnjacke ergänzt.

Hose, Handschuhe und Warnweste für die Drückjagd

Die Hose sollte regendicht und den Temperaturen angepasst sein. Eine lange Merino- Wollhose unter der Jagdhose hält die Beine warm. Normale Jagdschuhe wie der Alaska GTX sind bei normalen Temperaturen durch Einweg-Heizsohlen ergänzbar. So lässt es sich immer sicher laufen. Anders als mit schweren Winterstiefeln, die bei Kälte durchaus Sinn machen.
Neben dünnen Drückjagdhandschuhen, die die Schießfertigkeit erhalten, sind bei kaltem Wetter Handwärmer ein unverzichtbarer Bestandteil der Drückjagdausrüstung, um in jeder Situation den Abzug sicher zu beherrschen!
Mehrere orangene Warnwesten können bequem über eine frei auswählbare Jacke getragen werden, ohne eine Signaljacke nutzen zu müssen. Hierdurch ist der Jäger viel flexibler, was die Wahl hochwertiger Kleidung angeht. Zusätzlich über die Brüstung des Standes gehängt dienen weitere dünne Westen der Sicherheit.
Auf das Wesentliche fokussiert und puristisch ausgerüstet lässt sich die Jagd erfolgreich erleben; ohne sich in technischen Geräten zu verlieren oder frieren zu müssen.
Drückjagd auf Rotwild und Schwarzwild. Die Königsklasse der Bewegungsjagd
November. Leichter Wind, etwas Schnee auf den Zweigen. Da! Nahe dem Stand ein scharfer Standlaut. Der Laut lässt auf Sauen schließen. Weitere Hunde schlagen sich bei, alsdann mit geht es mit viel Radau und scharfem Hetzlaut los. Genau auf den Stand zu. Auf dem Wechsel sucht der Keiler sein Heil in der Flucht. Wie geplant. Die Hunde mit Sichtlaut auf Abstand dahinter. Jetzt liegt es nur noch am Schützen. Damit eine Drückjagd verwandelbare Chancen bietet, ist im Vorfeld enormer Aufwand nötig.
Die gut organisierte Drückjagd auf Rotwild und Schwarzwild gleicht einer Symphonie. Die optimale Vorbereitung und Planung, das Zusammenspiel aus Treibern, Hunden, Schützen und Helfern greifen ineinander wie die Zahnräder eines Schweizer Uhrwerks. Die penible Vorbereitung ist alles. Das Vorkommen der Zielarten Rot- und oder Schwarzwild entscheiden über den Einsatz von Treibern, Hunden, Hunderassen und der Art der Drückjagddurchführung.

Drückjagd auf Rotwild bei verschiedenen Witterungseinflüssen

Rotwild besitzt hervorragend ausgeprägte Sinne. Das bemerkt der Jäger immer wieder an der Schwierigkeit seiner Bejagung. Insbesondere bei der Drückjagd auf Rotwild. Verschiedene Witterungsbedingungen sind für die Bejagung von unterschiedlicher Bedeutung. Niederschläge sind eher untergeordnet, Schnee hat im alpinen Bereich eine wichtige und umfassende Sonderstellung, besonders bei der Riegeljagd. Kein Witterungseinfluss ist bei der Drückjagd auf Rotwild so entscheidend wie der Wind, da die olfaktorische Wahrnehmung die ausgeprägteste ist. Rein anatomisch kann man dies am langen Gesichtsschädel festmachen, da in dem langen Bereich zwischen Windfang und Siebbein sehr viele Riechzellen Platz finden. Das Rotwild als ursprünglicher Steppenbewohner ist stärker auf seine Riechleistung angewiesen als typische Waldbewohner, da Witterung im Offenland über viel größere Distanzen transportiert wird als im Wald und somit Feinde auch lange bevor sie eräugt oder vernommen werden, bereits zu wittern sind. Im Zuge der Feindvermeidung nutzt das Rotwild seinen Geruchssinn ständig.
Drückjagdwetter: Witterung ist alles
Sei es das einzelne Stück, welches stets mit dem Rücken zur Hauptwindrichtung ruht, um Gefahren von hinten vorzeitig winden zu können oder das Rudel, in dessen Verband immer einzelne Stücke winden, um Gefahrenquellen zu erkennen.
Nicht zu unterschätzen ist bei der Rotwilddrückjagd die Luftfeuchtigkeit, da Geruchspartikel bei hoher Luftfeuchtigkeit deutlich besser transportiert werden als bei Trockenheit. Hieraus ergibt sich auch die Tatsache, dass das Rotwild bei herbstlichen Drückjagden oft bereits beim Anstellen der ersten Schützen mit Wind beginnt, über Fernwechsel in sicherere Areale zu fliehen.

Drückjagd und Rotwild: Gegen den Wind

Wird das Rotwild zu Beginn der Drückjagd auf die Unruhe aufmerksam, rudelt es sich schnell zusammen. Das beruht auf seinem ureigenen Instinkt und ist Teil der Feindvermeidungsstrategien. Das Rotwildrudel versucht weiterhin Wind von Gefahrenquellen zu bekommen, um sich Übersicht zu verschaffen und somit eine sichere Fluchtmöglichkeit zu finden. Herrscht kräftiger Wind, ist das Wild nur schwer zu mobilisieren und verharrt in den Dickungen. Hat es stark geregnet und die Dickungen sind somit nass, werden sie eher vom Rotwild gemieden, da es dann die vom Wind eher getrockneten älteren Bestande bevorzugt aufsucht. Das Rotwildrudel flieht auch bei der Drückjagd niemals kopflos, sei es beschossen, getrieben oder von Hunden bejagt.
Wird das Rotwild bei der Drückjagd hochgemacht, flieht es unverzüglich stets gegen den Wind auf seinen ihm bekannten Wechseln. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Drückjagd auf Rotwild so zu planen, dass gegen den Wind getrieben wird.
Rotwild flüchtet nie mit dem Wind aus dem Drückjagdtreiben
Das Rotwild umschlägt andernfalls die Treiber und verbleibt in der Dickung, welche es nie mit dem Wind verlässt. Die Schützenstände sollten nie zu nahe am Einstand liegen, sondern in einiger Entfernung an gut belaufenen Wechseln mit gutem Wind sowohl für den Schützen als auch für das Rotwild. Die Stände dürfen sich keinesfalls auf einem Wechsel befinden, sondern in immer in einiger Entfernung, um ein sicheres Ansprechen zu ermöglichen sowie das Wechselverhalten des Wildes nicht zu stören. Das Rotwild verhofft oft kurze Zeit nach dem Verlassen der Deckung und wechselt in eine langsamere Gangart. Sollen zwei nebeneinanderliegende Treiben durchgeführt werden, so ist darauf zu achten, mit dem, dem Wind zugewandten Treiben zu beginnen. Andernfalls würde das Rotwild mit hoher Wahrscheinlichkeit in das nächste Treiben flüchten und dieses frühzeitig beunruhigen. Flüchtendes Rotwild auf einem Wechsel stellt die Gefahr des Überrennens für Treiber und Hundeführer dar bei der Drückjagd dar. Deshalb laufen Treiber niemals auf den Wechseln.

Rotwild- der Langstreckenflüchter auf der Drückjagd

Einmal in Bewegung gebracht, flieht das Rotwild oft über weite Strecken. Deshalb werden bei Rotwild Drückjagden möglichst niederläufige Hunde eingesetzt, um das Rotwild nicht unnötig weit durch große Hunde zu verfolgen.
Optimale Bedingungen einer winterlichen Drückjagd stellt trockenes Wetter mit wenig Wind dar, Schnee hilft, die bevorzugten Einstände näher zu lokalisieren. Drückjagden auf Rotwild sind ab Ende Dezember aufgrund der winterlichen Stoffwechselumstellung abzulehnen. Sämtliche Treiben sollten nach Möglichkeit so geplant und angelegt werden, dass auch die zur Jagdzeit regelmäßig vorherrschende Windbewegung und Richtung berücksichtigt wird.
Der richtige Zeitpunkt für die Drückjagd
Der Zeitpunkt zur Drückjagddurchführung muss wohlüberlegt sein und zu den jeweiligen Reviergegebenheiten passen. Jagdleiter berücksichtigen insbesondere in laubwaldreichen Jagdrevieren den Belaubungszustand der Laubbäume. Sind die Bäume Anfang Oktober noch nahezu komplett belaubt, hat das Wild noch viel Deckung, der Schütze im Gegenzug wenig Sicht auf das Wild. Jungbuchenbestände halten Ihr Laub oft bis in den Winter hinein und können auch so noch lange gute Einstände bieten. Zeitdruck herrsch in forstwirtschaftlich gut verjüngten Revierstrukturen also nicht. Jäger beenden aufgrund der Unruhe durch Bewegungsjagden, insbesondere der Beunruhigung des wiederkäuenden Schalenwildes, spätestens mit der Wintersonnenwende um den 21. Dezember herum die Bejagung in Form von Drückjagden. Eine das Wild mit Druck bewegende Jagd nach diesem Zeitpunkt hat viele negative Einflüsse auf das Wild und den Wald.

Wintersonnenwende und Wiederkäuer

Ab der Wintersonnenwende fährt das wiederkäuende Schalenwild den Stoffwechsel signifikant, etwa um die Hälfte herunter. Die Bewegungsaktivität wird stark eingeschränkt, die Pansenzotten bilden sich zurück, um mit weniger Nahrung zurechtzukommen. Zusätzlich verringert sich im Winter die Größe der Verdauungsorgane, wodurch sie selbst weniger Energie benötigen. Die Verdauungs- und Ruhephasen verlängern sich jedoch. Weiterhin wird die Körpertemperatur, insbesondere in den Extremitäten, stark auf bis zu nur noch etwa 17 °C verringert. Wird das Wild, welches sich in diesem äußerst effektiven Wintermodus befindet, nun bei einer Drückjagd in Bewegung gebracht und von Hunden angejagt, so muss der gesamte Kreislauf binnen kürzester Zeit hochfahren. Durch die verringerte Temperatur der Extremitäten hat das Wild dann nicht nur einen hohen Energieverbrauch, sondern kann auch anfangs nur eingeschränkt flüchten. Ab der Wintersonnenwende endet die Dormanz (Vortragezeit) des Rehwildes, während derer sich der Embryo nur langsam entwickelt. Die Embryonalentwicklung der anderen Schalenwildarten ist bereits in vollem Gange.
Keine Drückjagd ab Weihnachten!
Daraus resultiert, dass insbesondere ab etwa Weihnachten alles Schalenwild besonders viel Ruhe benötigt, um Energiereserven artangepasst zu sparen. Eine Drückjagd im Januar hat daher massive Wildschäden, insbesondere im Wald zur Folge, was in einer erhöhten Bejagung mündet. Ein Teufelskreis, den es zwingend fachlich zu durchbrechen gilt! Der ideale Zeitpunkt für die Drückjagd liegt durch die wildbiologisch bedingten Grundlagen und die jahreszeitlichen Vegetationszustände im Zeitraum von etwa Mitte Oktober bis aller spätestens Weihnachten mit einem Schwerpunkt, sofern Revierstruktur und Zeit- Raumnutzung der Zielarten das Erlauben, im November. Durch den hohen Eingriff in den Wildbestand zum richtigen Drückjagdzeitpunkt im November und spätestens zu Weihnachten mit maximaler Unruhe am Drückjagdtag zur Abschussplanerfüllung herrscht im restlichen Jahreslauf bis auf vorsichtige und effektive Eingriffe der Einzeljagd äußerste Jagdruhe zugunsten des Wildes und der forstwirtschaftlichen Situation.

Drückjagden besser im Herbst oder im Januar?

Wann Drückjagden am erfolgreichsten sind und zu welcher Zeit und aus welchen möglichen Gründen die meisten Fehlabschüsse passieren erklärt Revierjagdmeister Roman v. Fürstenberg an folgender Auswertung von Drückjagdergebnissen aus ganz Deutschland. Der Auswertung zugrunde lagen die Ergebnisse von 35 privaten Drückjagden (22 Herbst, 13 Januar) mit insgesamt 2.003 erlegten Stücken Schwarzwild und 291 erlegten Rehen. Diese Auswertung zeigt, wann Drückjagden aus welchen Gründen erfolgversprechender sind und was ein Erfolg eigentlich wirklich ist.
Herbst- gegen Januardrückjagden
Lassen sich bei herbstlichen- oder doch erst bei Januarjagden die größeren Strecken erzielen? Um dieser Frage nachzugehen, wird zunächst die durchschnittliche Strecke der auszuwertenden Drückjagden herangezogen.
Januarjagden erzielten im gesamten Durchschnitt eine um bis zu 9 % höhere Strecke als die herbstlichen Jagden. Diese 9 % stellen jedoch nur einen Durchschnitt von sechs Jagdjahren dar. In einigen Jahren lag der Erfolg der Januarjagden um 131 % höher, im schlechtesten Fall lagen Januarjagden sogar 51 % unter dem Erfolg der herbstlichen Drückjagd. Auch gab es Jahre, in denen kein Unterschied vorlag. Diese Ergebnisse lassen für sich allein genommen vorerst keine Rückschlüsse zu.

Der Erfolg pro Schütze bei der Drückjagd

Die Anzahl des pro Schützen erlegten Wildes ist eine interessante Kennzahl für die Erfolgsbewertung einer Jagd. Eine Strecke von 10 Stücken Wild kann durchaus ein sehr gutes Ergebnis darstellen, jedoch nicht, wenn an der betreffenden Jagd 30 Schützen beteiligt waren. Die Relation von Schützen zu erlegtem Wild gibt somit einen äußerst relevanten Wert an. Durchschnittlich lag die Strecke pro Schütze bei Drückjagden im Januar um 3 % höher als im Herbst. Wenn gleich diese Werte mit rund 1,8 und 1,9 Stücken je Schütze sehr eng beieinanderliegen. Differenzen einzelner Jahre: In 2 Jahren lag der Erfolg der Schützen im Januar unter dem im Herbst. Zwei Jahre waren im Januar erfolgreicher und eines weist ein Gleichgewicht zwischen Herbst und Januar aus. In jenem Jahr lag auch die durchschnittliche Anzahl erlegten Wildes im Herbst und Januar auf gleichem Niveau. Das zeigt, dass keine Unterschiede bestehen müssen, die prozentualen/ absoluten Werte liegen nahe beieinander.
Welche Stücke wurden auf der Drückjagd erlegt?
Als weiterer Faktor für die Erfolgsbeurteilung der Drückjagd werden die Streckenanteile der Wildarten in den jeweiligen Altersklassen erfasst. Eine hohe Strecke mit wenig Schützen kann auch eine negative Bilanz aufweisen, wenn ein hoher Anteil falscher Stücke auf der Strecke liegt.
Ein reifer Keiler auf der Strecke ist eine wahre Freude für den Erleger und für den Revierinhaber. Bei Bachen sieht das anders aus, Ihr Abschuss ist Sache der Einzeljagd, nicht zuletzt, um dem Muttertierschutz zu entsprechen. Weiterhin können Bachenabschüsse unkontrollierte Rauschen der Frischlinge sowie unkontrollierbare Wildschäden zur Folge haben.

Wann fallen die Bachen?

56 % der Bachen der ausgewerteten Streckenergebnisse kamen im Januar zur Strecke. Sicherlich ist das schwierigere Ansprechen des Wildes mit fortschreitendem Jahreslauf nicht von der Hand zu weisen. Eindeutige Hinweise jedoch gibt die Freigabe der jeweiligen Jagden. Jagdleiter gaben bei den Jagden, auf denen Bachen erlegt wurden, ganz gleich ob im Herbst oder im Januar, Frischlinge und reife Keiler frei. Ist es also vielleicht vielfach die Hoffnung auf einen guten Keiler, der den lockeren Finger vieler Schützen bei Drückjagden mit dieser Freigabe bedingt? Zu vermuten lässt dies jedenfalls die Tatsache, dass bei Drückjagden, auf denen ausschließlich Frischlinge freigegeben werden, auch meist ausnahmslos solche zur Strecke kommen. Hier liegt der Bachenanteil bei lediglich 0,35 %, im Gegensatz zu den Jagden, auf denen Keiler freigegeben waren, hier lag der Bachenabschuss bei 4 %.
Lüneburgermodell bei der Drückjagd
Insgesamt kamen bei den 2.003 Abschüssen 18 reife Keiler zur Strecke. Somit machen die eigentlich gewollten Stücke gerade einmal 38 % der adulten Stücke (0,9 % der Gesamtstrecke) aus. 62 % dieser Altersklasse sind also ungewollt erlegte Bachen (2,4 % der Gesamtstrecke). Daraus können wir schließen, dass die Freigabe von Keilern nicht im Verhältnis zum erzielten Erfolg steht.
Insgesamt weist die Auswertung von 2.003 Schwarzwildabschüssen auf Drückjagden folgende Klassenanteile aus:
Frischlinge :90 % (47 % männlich, 43 % weiblich)
Überläufer: 7 % (3 % männlich, 4 % weiblich)
Altersklasse: 3 % (1 % Keiler, 2 % Bachen)

Das Lüneburgermodell und weitere Grundlagen der Drückjagd

Diese Abschussverteilung liegt grundsätzlich an der Drückjagdfreigabe. Jedoch lässt sie in gewissem Maße auch auf den Bestandsaufbau schließen, ist doch bei einem theoretischen Schwarzwildzuwachs von 300 % des Gesamtbestandes ein Abschuss von 90 % aller Frischlinge des Jahrgangs notwendig, um den Bestand nicht anwachsen zu lassen. Eine Streckenliste, die diese Prozente aufweist, ist natürlich kein Nachweis für den vollständig erfüllten, notwendigen Abschuss dieser oder einer anderen Klasse, der Prozentanteil lasst jedoch bedingt Rückschlüsse zu. Der prozentual mögliche, höhere Erfolg sowie das erfolgreichere Verhältnis von Schützen zu erlegtem Wild im Januar hat verschiedene Gründe.
Auf der Suche nach Gründen für erfolgreiche Drückjagden
Zum einen hat sich die Vegetation im Jahreslauf so weit verändert, dass weniger Deckung vorhanden ist und das Wild somit leichter auf die Läufe gebracht werden kann.
Weiterhin ist das anwechselnde Wild gerade im Laubwald für die Schützen deutlich früher auszumachen und anzusprechen. Laub auf dem Boden, welches unter Umständen sogar angefroren ist, hilft den Schützen bei der Drückjagd zusätzlich ungemein durch die frühere akustische Wahrnehmung des Wildes.
Herbstliche Jagden bei teils voller Belaubung nehmen vielfach die Sicht. Auch bei gut freigeschnittenen Ständen. Selbst geringer Wind bringt das Laub an den Ästen ausreichend zum Rascheln, um jede frühzeitige Geräuschwahrnehmung zu erschweren oder sogar ganz zu verhindern. Hierin liegt auch eine Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse der durchschnittlichen Strecken zwischen Drückjagden im Herbst und Januar. War die Natur bei den sehr gut verlaufenen Herbstjagden phänologisch schon im Winter und bei den eher negativ verlaufenen noch im Spät- oder gar Vollherbst?

Das Wetter der Drückjagd- Ein Grund

Hierzu lassen die Monatsdurchschnittstemperaturen weitere Rückschlüsse zu, wenn sie mit den Jagdergebnissen in Zusammenhang gebracht werden. So lag die Durchschnittstemperatur im Dezember 2014 und im Januar 2015 gleichsam unter 5 °C. In diesem Jahr wurde auf den Bewegungsjagden im Herbst durchschnittlich genau so viel erlegt wie im Januar. Im Dezember 2015 lag die Durchschnittstemperatur knapp unter 10 °C. Erst im Januar sank sie auf unter 0 °C, was die Januarstrecken in ihrer Höhe jene des Herbstes um 131 % übertraf. Die Temperaturen und der Vegetationsstand sind also einer der ausschlaggebendsten Faktoren bei der möglichen Erfolgsbeurteilung. Die meisten Schützen sind im Januar bereits seit fast drei Monaten on Tour. Damit haben sie sich in der Praxis eingeschossen und sind fit. Das Schießen fällt leichter, da ein jeder jetzt oft wöchentlich auf Drückjagden unterwegs ist, sicher auch ein Grund, warum mehr Wild pro Schütze zum Saisonende hin erlegt wird.
Der richtige Zeitpunkt für die Drückjagd
Um hohe Drückjagdstrecken zu erzielen, sollte die Vegetationsstatus möglichst weit im Winter liegen, um den Schützen bessere Chancen zu verschaffen. Weiterhin sind im letzten Drittel der Saison alle Schützen gut eingeschossen. Um eine homogene Strecke zu erzielen und um nicht mit dem Muttertierschutz in Konflikt zu kommen, ist die ausschließliche Freigabe von Frischlingen geboten. Da das Wild, vor allem das wiederkäuende Schalenwild im Winter seinen Stoffwechsel extrem zurückfährt, sollte aus wildbiologischen Gründen auf Drückjagden im Januar gänzlich verzichtet werden. Auch beim Schwarzwild sind viele Bachen um diese Zeit bereits hoch beschlagen. Den Jagdstress in dieser Phase der Nahrungsknappheit gilt es möglichst zu vermeiden. Auch sind die Bachen, welche kurz vor dem Frischen stehen, deutlich gefährlicher für die Hunde.

Drückjagd im November

Hinzu kommt das erschwerte Ansprechen der flüchtigen Sauen mit fortschreitender Jahreszeit. Frischlinge mit 50 und mehr Kilogramm kommen durchaus vor, sind Sie im Revier die Regel, ist der Unterschied zu einem Überläufer oder einer Bache beim notwendigen schnellen Ansprechen äußerst gering, was zu ungewollten Fehlabschüssen führen kann. Besonders brisant, wenn Bachen gen Ende Januar bereits gefrischt haben und allein auf der Flucht sind. Der gesamte Schalenwildabschuss sollte spätestens zur Jahreswende erfüllt sein.
Die Drückjagd muss zwingend so früh wie möglich und so spät wie nötig stattfinden. Die Monatswende November/ Dezember (Mitte November bis Mitte Dezember) erscheint nach dieser Auswertung und den Erfahrungen als idealer Zeitpunkt für die Drückjagd auf Schwarzwild und Rotwild, um allen Ansprüchen gerecht zu werden.
Hygiene bei der Drückjagd- ASP Prävention
Die Revierhygiene vor- während- und nach der Drückjagd, ist von elementarer Bedeutung für die Gesundheit des Wildes und die Seuchenvermeidung/ Verschleppung beispielsweise der ASP oder KSP (Schweinepest) durch den Jäger. Um zu verhindern, dass die überaus resistenten Schweinepest-Viren ganz gleich, ob ASP oder KSP fortgeschleppt werden, gilt es zwingend einige hygienische Grundsätze zu beachten. Achtung: Ein Blutstropfen reicht, damit das Virus mehrere Monate bis Jahre darin überlebt.
Zunächst werden alle an der Drückjagd Beteiligten im Vorfeld darüber informiert, dass ihre Bekleidung bei min. 60 °C für min. 20 Minuten zu waschen ist und die Schuhe sowie sämtliches Jagdgerät wie Messer, Bergegurte, Halsbänder, Leinen, Hundeschutzwesten, Wildwannen und Waffen im Vorfeld intensiv gereinigt werden müssen, da nur einwandfrei saubere Schuhe und Kleidung desinfiziert werden können. Mit einem viruzid wirkenden Mittel wird das behüllte ASP- Virus bekämpft. Virkon S (1 % Lösung, Einwirkzeit 30 Sek.) hat sich für sämtliche Jagdausrüstung bewährt.

Seuchenvermeidung bei der Drückjagd ist Verantwortung für alle

Zusätzlich wird auf das Mitbringen von Wechselkleidung für nach der Jagd hingewiesen. Morgens am Tag der Drückjagd werden Fahrzeugreifen mit entsprechenden Mitteln wie Virkon- S oder Per-Essigsäure, die viruzid gegen die ASP-Viren wirken, eingesprüht. Alle Schützen, Treiber und Hundeführer müssen zwingend durch ein Laufbad laufen und die Einwirkzeit des verwendeten Mittels abwarten. Nur so kann der Jagdleiter sicherstellen, dass keine Schweinepest-Viren ins Revier getragen werden. Auch unsere vierbeinigen Jagdhelfer, die Jagdhunde, müssen desinfiziert/ Gewaschen werden. Es gehört sich keineswegs, noch das schweißverschmierte Messer von den letzten drei Drückjagden mit in ein fremdes Revier zu bringen. Und auch nach der Jagd ist noch lange nicht Schluss. So werden auch die Schuhe, die Westen und auch die Hunde nach der Jagd noch einmal desinfiziert, ebenso Autoreifen, damit falls schon ASP-Viren grassieren, diese möglicherweise nicht in fremde Reviere fortgeschleppt werden. Seuchenvermeidung ist die Verantwortung aller und sie ist penibel einzuhalten.
Gruppeneinteilung der Schützen bei der Drückjagd
Die eingeladenen Schützen werden auf die verschiedenen Stände im Revier verteilt. Die Standzuteilung erfolgt entsprechend der Schieß- und Ansprechfertigkeiten. Um möglichst wenig Unruhe ins Revier zu bringen, werden maximal 5 Schützen je Gruppe und pro Ansteller zusammengefasst. Am besten ist es, wenn je Fünfergruppe ein oder zwei geländegängige Fahrzeuge vorhanden sind und Gruppe mit ein bis zwei Fahrzeugen ins Revier kommt. Sollen Schützen Ihre Fahrzeuge nutzen, muss im Vorfeld die Reviertauglichkeit sowie die Bereitschaft zur Nutzung geklärt werden. Weiterhin sind dann auch etwaige Drückjagd - Fahrgemeinschaften in den Gruppenzuteilungen zu berücksichtigen. Türenschlagen und laute Gespräche sind natürlich auch dann tabu! Schützen im Zentrum der Treiben werden als letzte angestellt, jene an den äußeren Grenzen und an Fernwechseln zu Beginn. Das Anstellen der Jäger sowie die Streckenaufnahme und das Markieren der Anschüsse läuft zu 100 % über den Ansteller der Schützengruppe. Er ist das Bindeglied zu allen weiteren Funktionsträgern und zum Jagdleiter.

Parkplatzeinteilung für den Drückjagdtag

Je nach Größe der Jagd werden entsprechend viele Stellplätze für die Fahrzeuge benötigt. Grundsätzlich muss eine ausreichend große Parkfläche zur Verfügung stehen, auf der sich niemand festfahren kann. Andernfalls kommt der zeitliche Ablaufplan durcheinander. Je nach Größe der Drückjagd und Anzahl der Teilnehmer ziehe ich es vor, Treibern und Hundeführern einen anderen Treffpunkt als den Schützen zuzuordnen. Das entzerrt die Begrüßung, die Einweisung und auch das Abrücken in das Revier zu den jeweiligen Ausgangspunkten. Die Parkplätze werden im Vorfeld nach Gruppenzuteilung geplant und gut erkennbar beschildert.
Parkplatzeinteilung für den Drückjagdtag
Sowohl bei den Schützen als auch bei den Treibern wird jedes Fahrzeug bei Eintreffen begrüßt, die Anwesenheit auf einer Teilnehmerliste abgehakt sowie die schriftliche Belehrung und Gruppenzuteilung ausgehändigt, bei Schützen der Jagdschein/ Schießnachweis kontrolliert sowie von allen die Sicherheitsbelehrung und deren Erhalt mit Unterschrift bestätigt (Personenbezogene Daten werden hierbei DSGVO konform verarbeitet). Dann wird dem Fahrzeug der entsprechende Parkplatz zugewiesen. Nach der Begrüßung, Einweisung/ Sicherheitsbelehrung rücken die Gruppen sodann staufrei ab.

Gruppeneinteilung Treiber / Hunde, Gruppenführer Ansage & Sicherheitsbelehrung für die Drückjagd
Alle Hundeführer lassen am Treffpunkt ihre Hunde im Auto. Der Treffpunkt sollte nicht im Revier nahe den Treiben liegen. Wenn alle da sind, erfolgt die Begrüßung mit anschließender Sicherheitsbelehrung mit der erweiterten Belehrung, dass das Abfangen von Wild nur durch Hundeführer mit Jagdschein erfolgen darf sowie dass die Langwaffe ausschließlich mit gültigem Jagdschein und Unterladen oder Entladen mitgeführt werden darf und nur zum Fangschuss im unmittelbaren Nahbereich sowie auf von Hunden gestelltem Wild und zum etwaigen Selbstschutz genutzt werden darf.

Treiber- und Hundeführergruppen

Es folgt die Gruppenzuteilung und die Verteilung der Funkgeräte durch den Gruppenführer an seine Flügelmänner. Alsdann rücken die Gruppen zu Ihren Startpunkten im Revier ab. Dort angekommen weist der Gruppenführer einmal alle Gruppenmitglieder in das Treiben ein und gibt etwaige Kommandos und Zeiten bekannt. Sodann machen Hundeführer ihre Hunde fertig, um dann geschlossen ins Treiben aufzubrechen. Hierdurch wird jede Unruhe nahe der Treiben im Vorfeld minimiert und die Organisation der Treiberwehr erleichtert. Alle Autos sind auf den Parkbereichen an den jeweiligen Startpunkten stets abfahrbereit und dürfen keine Wege blockieren.
Verhalten auf dem Drückjagdstand

Das Verhalten des Jagdgastes auf dem Drückjagdstand ist von Anfang an wichtig für den Jagderfolg. Das korrekte Verhalten beginnt bereits beim Aussteigen aus dem Auto. Hierbei werden keine Türen geknallt und keine lauten Gespräche geführt. Der Jagdgast geht leise mit seiner Ausrüstung zum Stand, ohne hierbei viel Krach zu machen. Sofern Pirschwege sind, werden diese unbedingt benutzen. Gemäß der UVV wird der Jagdgast durch den Ansteller bis zu seinem Stand begleitet eingewiesen. Nach dem Einnehmen des Standes nimmt der Schütze umgehend Kontakt zu seinen sichtbaren Standnachbarn auf. Hierbei genügt ein Winken, damit beide voneinander Notiz nehmen. Neben der obligatorischen Warnkleidung ist es sinnvoll, wenn oben um den Drückjagdbock an den Seiten noch Warnwesten herumgehängt werden, sodass der Drückjagdstand für alle weithin deutlich sichtbar ist. Durch das Farbsehen des Schalenwildes ergibt sich hier kein Problem. Orange wird durch das Wild nicht als Warnfarbe, sondern einfach nur als Grauton wahrgenommen.
Wann wird der Schütze bei der Drückjagd nicht mehr schießen?
Je nach Durchführung der Drückjagd muss das Schießen unabhängig vom Ende des Drückjagdtreibens, nach ein oder zwei ungeklärten Anschüssen eingestellt werden. Ungeklärt sind die Anschlüsse dann, wenn der Jagdgast meint, getroffen zu haben, das Stück jedoch nicht in Sichtweite liegt und auch nicht sichtbar krank geflüchtet ist. Nach dem Ende des Treibens wird die Jagdausrüstung wieder zusammengeräumt und am Stand auf den Ansteller gewartet. Wild, das in Sichtweite liegt und nicht allzu schwer ist, wird direkt zum Stand gezogen. Vorbeikommende Treiber werden bereits im Treiben gebeten, Wild schon während des Treibens zum Stand zu ziehen, so wird das Bergen des Wildes enorm erleichtert.

Die Treiberwehr der Drück- und Bewegungsjagd

Bei jeder Treiberwehr gilt, dass der Treiberwehrführer in der Mitte geht und das Treiben sicher kennt. Unterstützt wird er durch seinen linken und rechten Flügelmann. Insbesondere in unübersichtlichen Bereichen und Einständen oder in schwerem Gelände müssen die Treiber zwingend laut treiben und sich gut aneinander orientieren, damit keiner verloren geht. Hierbei kann Technik wie die Hundeortung sehr sinnvoll unterstützen. Je dichter und schwerer das Gelände, desto unliebsamer wollen Treiber ins dichte. Hier sind zwingend solojagende Hunde einzusetzen. Sollte sich ein Standlaut entwickeln, wird ein Hundeführer gegebenenfalls mit einem Helfer dorthin beordert, um den Standlaut anzugehen. So lange hält die Treiberwehr.
Kommunikation bei der Drückjagd
Die Kommunikation untereinander ist nicht nur sicherheitsrelevant, sondern auch aus organisatorischen Gründen wichtig. Die einfachste Variante stellt das Smartphone mit entsprechenden Telefonlisten dar. Hierdurch kann nahezu überall eine zumindest halbwegs funktionierende Kommunikation sichergestellt werden. Durch Funklöcher und für die durchgängige Kommunikation ist hochwertiger CB-Funk immer primäres Sprechmedium zur Abstimmung.
Über Funkgeräte verfügen folgende Personengruppen mit getrennten, jedoch bekannt gegebenen Gesprächskreisen bei der Drückjagd: Jagdleiter, Koordinator, Treiberführer und Flügelmänner (drei Geräte pro Treiberwehr), zbV, Bergegruppen, Tierarzt, Schilderaufsteller/ Verkehrsposten.
Neben Mobilfunk und Funk bin ich aus der Praxis vom Tracker Hundeortungssystem überzeugt.
Hierbei wissen alle Nutzer permanent über sämtliche Bewegungen Bescheid. Vorausgesetzt möglichst viele Hundeführer auf einer Jagd verwenden diese Technik. Sofern der Jagdleiter im Vorfeld die Drückjagdtreiben, Stände sowie Besonderheiten kartiert hat, sind auch diese Informationen hilfreich. Der Sicherheitszugewinn sowie die jagdtaktischen Eingreifmöglichkeiten während der Jagd sind immens.

Wildbergung bei der Drückjagd

Die Gruppen zur Wildbergung werden bereits im Vorfeld zusammengestellt. Gruppen, die das erlegte Wild auf der Drückjagd bergen, benötigen insbesondere geländegängige Fahrzeuge, gegebenenfalls Anhänger und sollten aus mindestens drei Personen, wobei einer ortskundig sein muss, bestehen. Weiterhin bekommen diese Bergegruppen mindestens zwei hochwertige Bergegurte mit Haken, um auch schweres Wild aus unwegsamem Gelände bergen zu können. In Hanglagen und ähnlich schwierigem Gelände werden entsprechend mehr Personen eingesetzt. Unter Umständen kann auch eine Seilwinde am Fahrzeug sehr hilfreich sein.
Wildtransport nach der Drückjagd
In unwegsamem Gelände, welches nicht mit dem Fahrzeug angefahren werden kann, werden Trecker oder Quads eingesetzt. Der Schlepper mit Frontladerschaufel oder Heckkiste, besetzt mit zwei bis drei Personen, kann hier eine sehr schnelle Möglichkeit der Wildbergung bieten. Falls bei der Drückjagd auch ein Nachmittagstreiben durchgeführt wird, müssen die Bergegruppen zwingend über leistungsfähige Taschenlampen und Ersatzbatterien oder Ersatzakkus verfügen.

Wildbergung zu den Verladeplätzen für das Drückjagdwild

Zusätzlich bekommen sie eine Funkverbindung, um sich untereinander zu verständigen, aber auch um Verbindung zum Jagdleiter und zur Koordinationsstelle zu haben. Es hat sich bewährt, alle Ansteller nach der Drückjagd zusammen zu holen und ihre Listen mit dem erlegten Wild und den jeweiligen Ständen zentral aufzunehmen. Optimal kann hierfür beispielsweise eine Excel-Tabelle genutzt werden. Aus der Gesamttabelle werden dann einzelne, den Bergegruppen entsprechende Tabellen exportiert, die die exakte Anzahl des Wildes an den verschiedenen Ständen beinhalten. Chronologisch sortiert, entsprechend der besten und kürzesten Fahrstrecke.
Koordination bei der Wildbergung einer Drückjagd
Aus der Aufnahme des erlegten Wildes wird eine Bergeliste exportiert. Hierzu wird im Vorfeld eine Fahrtstrecke der einzelnen Stände festgelegt und auch das Fahrzeug, welches an diesen Ständen bergen fährt. Im unwegsamen Gelände, wo mit dem Trecker geborgen wird, werden Treffpunkte festgelegt, an denen das Wild auf einen Pkw-Anhänger umgeladen wird. Die Bergegruppen des Drückjagdteams bekommen dann, nachdem die gesamte Strecke aufgenommen worden ist die entsprechenden Bergelisten. Diese Listen arbeiten sie dann chronologisch ab und fahren und bergen das erlegte Wild, welches von den Schützen und auch von den Helfern bzw. den Treibern bereits zu den Ständen gezogen wurde.
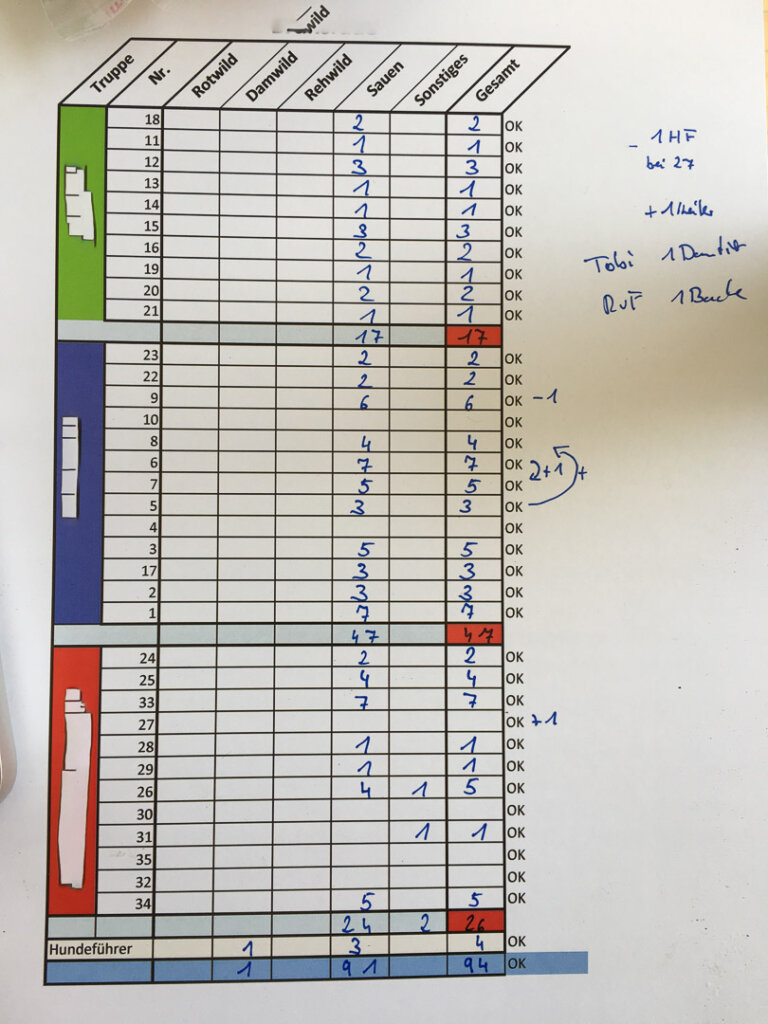
Gruppe Aufbrechen/ Wildbrethygiene bei der Drückjagd

Das Bergen muss im Sinne der Wildbrethygiene, insbesondere bei der Drückjagd möglichst zügig ablaufen. Deshalb ist die chronologische Streckenplanung von entscheidender Bedeutung.
Nach dem unverzüglichen Wildtransport aus dem Treiben heraus zum zentralen Aufbrechplatz, ist das saubere und hygienische Aufbrechen der Drückjagdstrecke essenziell für die Gewinnung des hochwertigen Lebensmittels. Am Aufbrechplatz/ Wildkammer im Idealfall müssen neben Helfern für diejenigen, die das Wild versorgen, bei großen Strecken am besten Schlachter, einige Mindestanforderungen erfüllt werden. Zur ergonomischen Arbeitsweise zählen Aufbrechböcke oder die Möglichkeit, das Wild im Hängen aufzubrechen. Weiterhin scharfe Messer, Gekrösemesser, Sägen und Wetzstähle sowie Konfiskat- Tonnen für die Aufbrüche und wassergefüllte Sammelbehälter für Herzen und Lebern. Es wird sichergestellt, dass ausreichend Beleuchtung zum sauberen Aufbrechen installiert ist. Darüber hinaus haben sich in der Praxis größere Wildgalgen und Rohrbahnen als sehr sinnvoll erwiesen, an denen das aufgebrochene Wild aufgehängt und mit Trinkwasser sauber ausgespült wird.
Klare Regeln der Wildbrethygiene für die Drückjagd
Personen, die Wild aufbrechen, müssen kundig für die Totbeschau sein, sofern das Wild dem Wildhandel zugeführt wird, also Kundige Person entsprechend der EU-Hygieneverordnung. Das langsame Herunterkühlen der Wildkörper muss sichergestellt sein, insbesondere bei höheren Temperaturen im Herbst. Eine zu schnelle Kühlung des Wildes führt mit dem Cold- shortening- Effekt zu schockartiger Verkürzung der Muskelfasern was die gewollte Fleischreifung verhindert und hierdurch die Wildbretqualität nicht nur negativ beeinflusst, sondern nachhaltig mindert. Das Wild sollte zunächst ein paar Stunden bei geringer Raumtemperatur auslüften, bevor es in den Kühlraum gehängt wird. Dieser hat eine Temperatur von etwa 1-2°C, um dem Bakterienwachstum entgegenzuwirken und die Kühltemperatur für Schalenwild von maximal plus 7°C sicherzustellen. Auch für die Aufbrechenden/ Schlachter muss gesorgt sein! Regen- und Windgeschützte Sitzgelegenheiten für etwaige Wartezeiten, Kaltgetränke, Kaffee/ Tee, Belegte Brötchen oder eine Suppe, je nach Gegebenheiten sind nicht nur Wertschätzung, sondern auch Grundlage guter und langfristiger Zusammenarbeit.

Checkliste Aufbrechplatz der Drückjagd

- Haken
- Rohrbahn oder Wildgalgen
- Messer
- Messerschärfer/ Stahl
- Latexhandschuhe
- Licht
- Fließendes Wasser in Trinkwasserqualität
- Handwaschbecken
- Schürzen
- Stichschutzhemden
- Konfiskatbehälter
- Aufbrechböcke oder Hängeoption
- Möglichkeit, Wild aufzuhängen
- Behälter für Herzen und Lebern
- Sitzgelegenheit, Wetterschutz
- Brötchen, Kaffee, Getränke etc.
- Helfer
- Ggf. Probennehmer für ASP-Proben, Blutproben, Trichinenproben (dann mit Wildursprungsscheinerstellung und Wildmarken)
Auf dem Drückjagdstand angekommen
Auf dem Stand wird die Ausrüstung leise ausgepackt und sofern notwendig bereitgelegt. Als dann sieht der Schütze sich, nachdem er sich ordentlich eingerichtet hat, in seiner Umgebung um. Hierbei ist es wichtig, nach Wechseln zu schauen, die dem Jagdgast möglicherweise vom Ansteller zuvor bekannt gegeben wurden. Bereiche, in die hineingeschossen werden kann, ohne jemanden oder Nachbarn zu gefährden, werden ebenso in Augenschein genommen wie die Bereiche, in die keinesfalls hineingeschossen werden darf. Die möglichen Schussentfernungen in den Schusssektoren werden abgemessen, um keine zu weiten Glücksschüsse zu probieren. Für die gesamte Zeit des Treibens ist der Jagdgast dann absolut aufmerksam und versucht frühestmöglich Wild wahrzunehmen. Ob man hierbei sitzt und sich sehr wenig bewegt, gegebenenfalls auch vorher mit dem Fernglas auf weitere Entfernungen anspricht, oder ob man permanent steht und sich langsam drehend bewegt, um frühzeitig auch von leisem Wild wie dem Fuchs Notiz zu nehmen, ist hierbei dem Jagdgast überlassen.

Streckelegen bei der Drückjagd?!

Ob die Strecke der Drückjagd traditionell gelegt und verblasen wird oder nur symbolisch, hängt von mehrerlei Faktoren ab. Das ordentliche traditionelle Streckelegen der gesamten Strecke nach Wildart, Geschlecht und Stärke mit anschließendem Verblasen mit den entsprechenden Totsignalen im Feuerschein von Fackeln und Feuerkörben bietet dem Jagdtag einen würdigen und stilvollen Abschluss. Jedem Schützen wird das Ergebnis des Handelns am Jagdtag bewusst und die Ehrfurcht vor dem Leben und der Kreatur, dem uns anvertrauten Wild, bleiben erhalten. Die Wildbrethygiene ist jedoch stets einzuhalten. So kann bei geringen Außentemperaturen die vollständige Strecke gelegt werden, wenn das Wild hierbei auf sauberen Planen liegt und nicht durch den Dreck gezogen wird. Damit das Streckelegen zügig und hygienisch abläuft, sind viele Helfer notwendig, ein Kreuzlinienlaser hilft bei der Ausrichtung und das Streckengrün wird zuvor bereitgelegt, ebenso Fackeln und Feuerkörbe. Bei höheren Temperaturen sollte die Strecke aus hygienischer Sicht nur symbolisch- das stärkste Stück jeder Wildart gelegt werden.
Checkliste zum Streckelegen einer Drückjagd
- Helfer, mindestens 3, besser 5 Personen oder je nach Streckenerwartung mehr- viele Hände, schnelles Ende
- Fackeln in ausreichender Anzahl, Hammer und Dorn, um Fackeln zu stecken
- Feuerkörbe oder Schwedenfeuer für die Ecken
- Anzünd- Hilfsmittel wie ein Gasbrenner
- Kreuzlinienlaser als Hilfsmittel zur ordentlichen Ausrichtung großer Strecken
- Planen als hygienische Wildunterlage
- Bläser (Bläser stehen hinter dem Wild), (Treiber zu den Läufen des Wildes und Schützen vor der Strecke)
- Vorgefertigte Erlegerbrüche für die Bruchübergabe
- Vorbereitete Inbesitznahmebrüche und letzte Bissen
- Ggf. elektrische Beleuchtung zum Streckelegen

Nach der Drückjagd: Schüsseltreiben und Waffenaufbewahrung

Früher war es üblich: Nach der Drückjagd wurden sämtliche Waffen mit ins Lokal zum Schüsseltreiben gebracht. Der Anblick von Waffen an der Garderobe hängend war im Wirtshaus, insbesondere in ländlichen Regionen, noch bis in die 2000 er Jahre nichts Ungewöhnliches. Auch nicht, wenn es Bier und Schnaps gab. Das Waffengesetz ist mittlerweile deutlich strenger. Alkohol und Waffen haben bei verantwortungsvollen Jägern absolut nichts miteinander zu tun. Wohin aber mit dem Gewehr nach der Jagd? Das Auto ist ortsveränderlich und somit kein Sicherer Ort für die Waffenaufbewahrung! Die Notlösung: Das Gewehr ordnungsgemäß im verschlossenen Koffer oder Futteral, die Einverständnis des Hausrechtsinhabers vorausgesetzt, beim Essen dabei. Dann jedoch kompletter Alkoholverzicht und direkt nach dem Essen geht es nach Hause. Der Beste Weg, insbesondere bei Drückjagden, zu denen die Jäger von weiter her anreisen ist die vorübergehende Lagerung im Tresor des Einladenden.
Sanktionen und Strafen bei der Drückjagd
Eine winterliche Drückjagd, das Wetter ist hervorragend,- kalt, klarer Himmel und es liegt Schnee. Die Freude beim Schützen ist groß, als er die Treiber kommen sieht. Er schießt. Erfolgreich. Er hat Beute gemacht. Jetzt wird er die Treiber Einweisen, um den Überläufer zu bergen.
Als die Treiber mit sich mühen und mit der Sau näherkommen, erkennt er an ihren Minen, dass etwas nicht stimmt. Am Stand angelangt sind alle wortkarg, ein kurzes „Waidmannsheil“, dann geht die Korona weiter.
Es liegt eine Bache. Und jetzt? Wie soll er es dem Beständer sagen? Wie wird der Jagdleiter reagieren? Wird Jagdgericht gehalten? Wird es Teuer? Was wäre teuer? Selbstanzeige, falls sie führend war? Jagdschein weg? Wie werden die Anderen Jäger reagieren. Alles Fragen, die einem nun durch den Kopf schnellen, dazu noch das schlechte Gewissen, richtig Scheiße gebaut zu haben. Leugnen Zwecklos. Die Jagd ist gelaufen, es waren nur Frischlinge frei.

Warum wird Fehlverhalten bei Bewegungsjagden sanktioniert?

Ganz einfach, weil es sich um ein vorsätzliches oder aber meist fahrlässiges Handeln des jeweiligen Schützen handelt. Dieses duldet der Revierinhaber nicht. Die jeweiligen Strafen sollen zur Besserung und künftigen Wahrung der gemachten Vorgaben führen.
Zu unterscheiden sind jene Fehlverhalten, die ausschließlich die Vorgaben des Jagdleiters betreffen und jene, die auch einen Gesetzesverstoß darstellen. Oft sind beide Kategorien betroffen.
Gesetzliche Verstöße bei der Drückjagd: Der Elterntierschutz
Wird beispielsweise eine führende Ricke erlegt, die zugehörigen Kitze jedoch nicht, so stellt dies den Straftatbestand einer Schonzeitverletzung nach § 22 Abs. 4 BJagdG dar. „In den Setz- und Brutzeiten dürfen bis zum Selbstständigwerden der Jungtiere die für die Aufzucht notwendigen Elterntiere, auch die von Wild ohne Schonzeit, nicht bejagt werden.“ Hierbei handelt es sich keineswegs um eine Ordnungswidrigkeit. Die Höhe solch einer Straftat regelt.
§ 38 Abs. 3 (2) BJagdG „[…] Entgegen §22 Abs. 4 Satz 1 ein Elterntier bejagt. (2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.“ Wird der Täter nun wegen solch einer Rechtswidrigen Tat nach § 38 BJagdG verurteilt, kann ihm nach §41 BJagdG der Jagdschein entzogen werden.

Zuverlässig bleiben

Die erforderliche, persönliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe verurteilt worden sind. Das würde bedeuten: Jagdschein- weg, Waffenrechtliche Bedürfnis- weg; WBK- weg; Waffen- weg; Verlust eines ggf. gepachteten Reviers, „Das war’s dann erst mal mit der Jagerei“. Eine Selbstanzeige kann Strafmindernd wirken und es sollte dem Revierinhaber erspart bleiben, seinen eingeladenen Gast anzeigen zu müssen.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorgaben des Jagdleiters bei der Drückjagd
Grundsätzlich ist den Anweisungen des Jagdleiters Folge zu leisten.
Fehlabschüsse können jedoch vorkommen. Vorsatz sei hier auszuschließen. Mal etwas zu schnell geschossen, nicht richtig angesprochen, schlechte Sicht und schon ist es passiert. Freisprechen kann sich von so etwas niemand.
In vielen kleinen, traditionell geführten Revieren wird Jagdgericht gehalten. Hier wird dem „Missetäter“ auf amüsante und lehrreiche Weise sein Drückjagd- Fehlverhalten aufgezeigt und meist mit kleinen Strafen, die der Jagdgesellschaft beim Schüsseltreiben zugutekommen, geahndet.
Bei großen Privat- und Verkaufsjagden sehen die Strafen meist anders aus. Das kann vom ernsten persönlichen Gespräch unter vier Augen über auszuführende Hegemaßnahmen im Revier bis hin zu hohen Geldstrafen gehen.
Will ein Revierinhaber mit solch hohen Geldstrafen etwa nur seine Jagdkasse füllen? Wohl kaum. Die Strafen sollen von vornherein eine abschreckende Wirkung haben, weshalb sie auch nicht gering sind. Etwaige Strafzahlungen fließen jedoch zumeist in die Hegemaßnahmen der Reviere oder werden für wohltätige Zwecke aufgewendet.

Fehlverhalten auf der Drückjagd minimieren

Wie kann ein Fehlverhalten auf der Drückjagd von vornherein minimiert werden? Das A und O scheint mir hier nicht nur die Strafhöhe, sondern insbesondere die äußerst klare Ansage des Jagdleiters vor der Jagd zu sein. Werden hier schwammige Aussagen getroffen „Wir jagen auf Schwarzwild“, „was der Jagdschein erlaubt“ etc. ist davon auszugehen, das falsche Stücke liegen werden. Falsch im Sinne von eventuell führenden Stücken oder einfach Wild, von dessen Abschuss man im Rahmen einer Gesellschaftsjagd absehen sollte- Überläuferbachen beispielsweise.
Sind die Aussagen des Jagdleiters absolut klar und kurz erläutert, so bestehen keine Zweifel. Die Erläuterungen sich wichtig, damit jedem klar wird, was gemeint ist und für Jungjäger stellen sie eine Hilfe dar.
Deutliche Ansage des Drückjagdleiters
Die Jagdleiter Ansprache bei der Drückjagd muss deutlich sein: „Wir jagen heute auf Frischlinge und ausschließlich auf diese! Frischlinge sind braune Sauen, welche in diesem Jahr gefrischt wurden. Ich werde keine Fehlabschüsse, mit welcher Erklärung auch immer akzeptieren oder tolerieren. Ich sehe Zuwiderhandlungen als persönlichen Angriff gegen mich. Wer auf Sauen außer Frischlinge schießt, missachtet meine Ansage. Das wird nicht toleriert“.
Hier gibt es kein Wenn und Aber. Sind die Schützen diszipliniert und entsprechend „eingenordet“ so kann von einer hervorragenden Streckenverteilung ausgegangen werden, bei der die Fehlabschüsse sich im geringsten Rahmen belaufen werden. Schützen und Jagdleitung müssen zu 100 % zusammenarbeiten.

Alle Sauen Frei! Der größte Fehler bei der Drückjagdfreigabe

Bei Drückjagden werden wegen der Schäden oft „alle Sauen“ freigegeben, hiermit meint der Jagdleiter jedoch keinesfalls die Bache. Wer diese erlegt, macht sich wie zuvor beschrieben strafbar, indem er den Elterntierschutz verletzt.
Gerade beim Schwarzwild, wo die meisten Fehlabschüsse vorkommen, ist es oberstes Gebot, diese zu verhindern. Andernfalls wird die Bestandesstruktur gefährdet.
Tote Bachen frischen nicht! Da wir im Folgejahr auch jagen wollen, benötigen wir auch einen angemessenen Bestand. Eine Erlegte „Schadbache“, deren 5 Frischlinge im Spätsommer führungslos sin, ist ein herber Verlust in mehrerlei Hinsicht:
- Diese reife Bache bringt im nächsten Jahr keinen Nachwuchs
- Die führungslosen Frischlinge werden unkontrolliert zu Schaden gehen
- Die Frischlinge würden in einer intakten Struktur mit Bache nicht rauschig, bzw. nicht Beschlagen
- Werden Frischlinge beschlagen, fehlen ihnen im ersten Lebensjahr enorme Reserven, die sie für die körperliche Reifung benötigen
Schwarzwild wird nach dem Lüneburger Modell bejagt. Der Abschuss reifer Stücke ist Sache der selektiven Einzeljagd.
Offener Umgang mit Fehlern
Ist dem Schützen auf der Drückjagd doch mal etwas schief gegangen, so wird offen damit umgegangen. Das bedeutet nicht, dass sofort jeder mitbekommen muss, dass jemand etwas nicht Freigegebenes erlegt hat. Offen heißt hier, zu seinem Fehler zu stehen, ihn direkt dem Jagdleiter zu melden und sich mit den Konsequenzen einverstanden zu zeigen. Es ist unwaidmännisch, Fehlabschüsse auf der Drückjagd nicht zu melden, oder darauf zu bestehen, dass es kein Fehlabschuss ist. Auch ist es nicht korrekt, etwaige Fehlabschüsse dem Sitznachbarn in die Schuhe zu schieben und zu melden, dass das Stück bereits krank rank war, als es schließlich erlegt wurde. Weiterhin werden die Beständer bei wiederholten Vorfällen dieser Art wohl auf künftige Jagdeinladungen verzichten, was eine weitere Strafe darstellt.
Die teils horrenden Geldstrafen bei Gesellschaftsjagden sind sicherlich nicht für jeden leicht zu verkraften, umso besser ist es, sicher anzusprechen und bei Unsicherheiten nicht zu schießen.

Sanktionen bei der Drückjagd: Ein eingeschränktes "Ja"

Sanktionen oder auch Geldstrafen sind bei der Drückjagd ein umstrittenes Terrain.
Ich kann sowohl Befürworter als auch Gegner verstehen und kann für beide argumentieren. Es kommt auf die weiteren Voraussetzungen an, ob ich Geldstrafen für sinnvoll erachte oder nicht. Bei privaten Jagden unter Freunden halte ich Geldstrafen für grundfalsch!
Als grundsätzlicher Fürsprecher jedoch kann ich sagen, dass sich genug Schützen mit Gleichgültigkeit auf Verkaufsjagden treffen. „Was interessiert es mich, ob ich auf der Drückjagd etwas Falsches schieße?“ Bei solch einer Denkweise gibt es keine Einsicht, nur einen leidenden Wildbestand. An dieser Stelle halte ich Geldstrafen für das nahezu einzig probate Mittel neben der nicht- Wiedereinladung. Die Drohung, dass es keine Folgeeinladung gibt, wird nur allzu oft ignoriert. Eine schmerzliche Geldstrafe jedoch hält schon einige Missetäter im Vorhinein von Verfehlungen ab. Wichtig hierbei ist, dass die Strafe wirklich grenzwertig hoch im Schmerzbereich liegt, für 50€ machen sich die wenigsten Gedanken.
Klare Regeln für Strafen
Wird diese Strafe bereits frühzeitig genannt, hemmt sie sicherlich den ein oder anderen Schützen mehr Strecke zu machen, da exakter angesprochen wird, die „schwarzen Schafe“ können hierdurch jedoch am wirkungsvollsten herausselektiert werden. Fehler können überall und jedem passieren, daher sollte eine Geldstrafe von 1.000 € und mehr nicht an einer exakten Gewichtsbegrenzung von kleinlichen xx kg hängen, sondern an klar definierten Grenzen: Adulte Stücke, Kronenhirsche, führende Stücke etc. Bei führenden Stücken, welche noch nicht selbstständige Jungtiere führen, kommt weiterhin ein Straftatbestand hinzu. Bei fehlerhaft und vorsätzlich falsch erlegten Trophäenträgern sollte nicht nur eine Geldstrafe ausgesprochen, sondern auch die Trophäen einbehalten werden.
Wer vorsätzlich Fehlabschüsse tätigt, die nicht der Freigabe entsprechen, gehört auf anonymen Drückjagden bestraft. Im Vorhinein müssen Verstöße klar definiert und Strafhöhen genannt werden, eine klare Ansprache des Jagdleiters verhilft schon grundlegend Fehler zu minimieren. Dass nach wiederholten Verfehlungen keine Einladung mehr folgt, sollte jedem Jäger klar sein.

Drückjagd: Nach der Jagd ist vor der Jagd- Wichtige Daten nutzen!
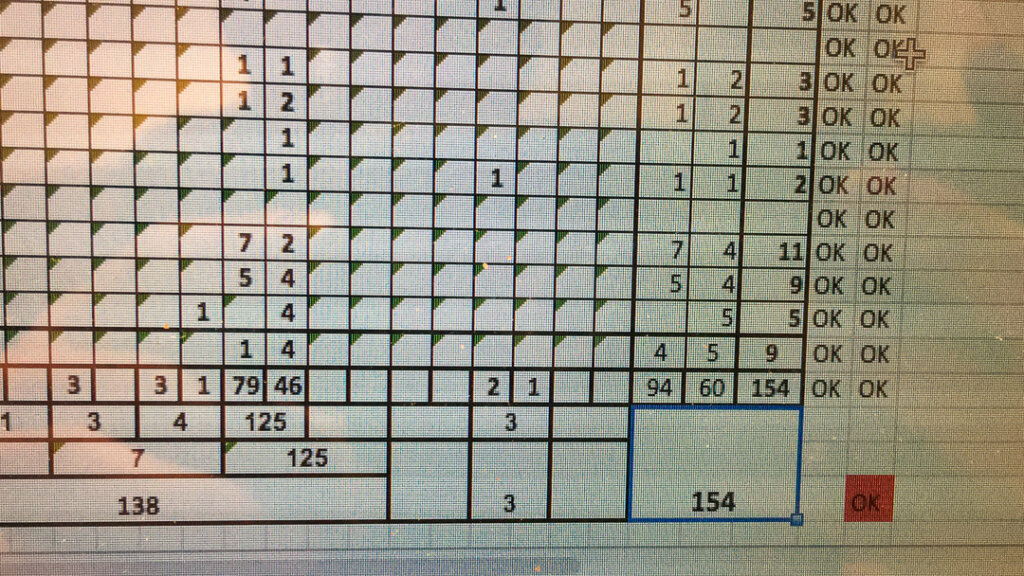
Aus genau diesem Grund gilt es, möglichst viele „Datensätze“ jeder Drückjagd zu sammeln. Nur so können Rückschlüsse aus dem erzielten Erfolg und über die angewandten Strategien gezogen werden.
Man mag einwenden, dass diese Formen der „Verwirtschaftlichungen“ des Wildes und des Jagdbetriebes, vielfach „Wildmanagement“ genannt, nichts mit waidgerechter Jagd zu tun haben. Bei aller Technisierung mit Nachtsicht-, Wärmebild- und Drohnentechnik sowie Ausweitung von Jagdzeiten und Aufhebungen des Nachtjagdverbotes auf Wiederkäuendes Schalenwild sollten wir uns fragen, ob dies der Richte Weg ist, um mit dem uns anvertrauten Wild umzugehen. Das zuvor angesprochene erheben von „Datensätzen der Drückjagd“ und der Umsetzung hingegen sind schlicht sauberes, jagdliches Handwerk, welches den Stress des Wildes durch möglichst effektive Drückjagdstrategien minimiert. So wird ein stressfreier, gesunder Wildbestand angepasst bejagt.
Alle Drückjagddaten, die wir erlangen können, werden archiviert. Eine Auswertung kann nach der Jagd aber auch noch nach Monaten oder Jahren sinnhaft sein und interessante Rückschlüsse bieten.
Erlegtes Wild der Drückjagd gesamt
Wie viel Wild wurde erlegt? An dieser Zahl lässt sich zunächst nur ablesen, ob die Drückjagdstrecke den Erwartungen entsprach. Die absolute Strecke sollte dem Ziel der Abschöpfung des Zuwachses möglichst entsprechen. Welches Wild kam in welcher Anzahl zur Strecke? Kam trotz der geplanten Drückjagd auf Schwarzwild nur wenig Schwarzwild zur Strecke, dafür aber zahlreiche Rehe, so passt entweder die Jagdstrategie nicht zur Zielwildart oder die Sauen sind im jeweiligen Revier mehr Wunsch als Realität. In beiden Fällen ist die Jagdstrategie zu überdenken und zu optimieren.

Erfolgreiche Drückjagdstände

Ein sehr aussagekräftiger Faktor ist jener über die Drückjagdstände, von denen aus erfolgreich Wild erlegt wurde. Weiterhin gilt es auch hier nicht nur die absolute Zahl, sondern natürlich auch die jeweilige Wildart zu archivieren. Je erfolgreicher ein Stand, desto wichtiger ist er für den Verlauf der Jagd. Hierbei ist zusätzlich auch der Wind zu notieren. Je nach vorherrschender Windrichtung, die nicht mit der eigentlichen Hauptwindrichtung übereinstimmen muss, können Stände absolut fängisch und den Jagdkönig hervorbringen oder eine wahre Nullnummer sein.
Die erfolgreichen Drückjagdstände sind nichtsdestotrotz jährlich neu auf den Prüfstand zu stellen. Durch die Veränderungen der Waldbestände und der damit verbundenen Einstandssituation kann eine Anpassung an die sich verändernden Situationen notwendig oder sinnhaft sein. Ebenso werden sich verändernde Wechsel in die Überlegungen mit einbezogen.
Ungefähre Anzahl Schüsse auf der Drückjagd
Die Anzahl der gefallenen Schüsse gibt Rückschlüsse über die Qualität der Drückjagdschützen, aber auch auf die Qualität der Stände. Fallen auf kurze Distanzen an übersichtlichen Ständen übermäßig viele Schüsse, ohne dass Wild zur Strecke kommt, oder es kommt zu vielen Nachsuchen, ist ein vorheriger Besuch im Schießkino oder noch besser auf den laufenden Keiler anzusetzen. Das schlechte Schussverhältnis kann jedoch auch auf falsch platzierte Stände mit zu großen Schussdistanzen zu den genutzten Wechseln oder schmalen Schussschneisen hindeuten. Gute Schuss- Wildverhältnisse sind besser als 1:3,5. Schlecht wird es ab 1:4.

Erfolgreiche Drückjagdschützen

Nicht selten sind es stets dieselben, die auf jedem Stand viele Chancen verwirklichen können. Gute Schützen sind rar. Gerade deshalb werden die besten Schützen auf die besten oder erfolgversprechendsten Stände gesetzt. Es gilt immer das Motto „Killerschützen gehören auf Killer Stände!“ Hierdurch wird die Gesamtstrecke zielgerichtet gesteigert und viele andernfalls eventuell notwendigen Folgebejagungen werden unnötig. Drückjagdstände zu verlosen, zeugt von Unkenntnis des Jagdleiters über die Qualität seiner Stände und seiner Schützen. Das Los gehört damit weiterhin auf die Kirmes, keinesfalls jedoch auf die Drückjagd! Die guten Schützen werden frühzeitig im Jahr eingeladen, im Idealfall noch während der laufenden Saison für das kommende Jahr.
Erlegtes Wild pro Schütze einer Drückjagd
Hier wird es interessant. Das durchschnittlich pro Schütze erlegte Wild setzt die Strecke in Relation zu den teilnehmenden Schützen. Diese Zahl offenbart den Erfolgsfaktor einer Drückjagd. Andernfalls steht ein Streckenergebnis ohne jede Relation im Raum. Wie erfolgreich war denn eine Drückjagd mit einer Strecke von 80 Stück Schalenwild? Mit 200 Schützen ein absoluter Misserfolg mit 0,4 erlegten Stücken Wild pro Schütze. Trotzdem hat auch solch eine Jagd einen hohen Grad an Vorbereitungsaufwand. Nahmen an der genannten Jagd jedoch nur 19 Schützen teil, entfallen in Durchschnitt 4,2 erlegte Kreaturen auf jeden Schützen. Hierbei kann von einer sehr erfolgreichen Jagd gesprochen werden. Die Drückjagdorganisation sollte so gestaltet sein, dass je Schütze im Schnitt wenigstens ein Stück Wild erlegt wird. Werte von bis zu 1:7 zeigen die Königsklasse. Der planerische Aufwand ist hierbei ebenso hoch, wie 200 Schützen irgendwo erfolglos im Wald zu platzieren, nur eben mit dem gewollten Ergebnis.

Einstände richtig Einschätzen

Die vom Wild genutzten Einstände sind der steten Veränderung der Waldbestände unterworfen. Aus diesem Grund sind vor und nach jeder Drückjagd die Einstände zu kartieren. Mit der notwendigen Weitsicht können bereits einige Jahre voraus die künftigen Einstände prognostiziert werden und die Jagdstrategien sowie die Stände sukzessive dahin ausgerichtet werden. Erfolgreiche Planung und Durchführung von Drückjagden und Bewegungsjagden im Allgemeinen ist nie Stillstand, sondern stete Veränderung und Optimierung!
Wildbewegung im Treiben der Drückjagd
Über die Fluchtwechsel und die Wildbewegungen können Schützen, Treiber und Hundeführer nach der Drückjagd informieren. Daraus entsteht ein schlüssiges Bild. Idealerweise anhand einer Karte. Nicht selten gibt es noch Fluchtwechsel, über die sich viel Wild dem Treiben entzieht, die bei der Planung niemand wirklich auf dem Schirm hatte. Interessante Rückwechsel kristallisieren sich ebenfalls häufig erst im Treiben heraus. Gerade im Bezug der genutzten Wechsel und der Wildbewegung ist immer auch der am Drückjagdtag vorherrschende Wind- sowohl die Hauptwindrichtung als auch der Individualwind in den Beständen zu berücksichtigen. Anhand der Wildbewegungen können die Strategie der gesamten Jagd und die Platzierung der Stände stets im Kleinen verbessert werden.

Reihenfolge des Abstellens der Drückjagdtreiben

Insbesondere in Bezug auf den Wind, ganz besonders bei der Drückjagd auf Rotwild, ist auf die Reihenfolge des Abstellens der Schützen besonderes Augenmerk zu legen. Je nach vorherrschender Windrichtung, kann ein verkehrtes Anstellen schnell dazu führen, dass ganze Rudel bereits mit dem Abstellen der ersten Schützen das Revier weiträumig verlassen. Hierdurch ist eine zielgerichtete, effektive Bejagung der betreffenden Wildart schnell unmöglich. Je nach Windrichtung sollte es zwei Alternativen geben, sodass in jeder Situation auch aus dem Treiben flüchtendes Wild schon erlegt werden kann. Schützen werden weiterhin stets von außen nach innen abgestellt. Insbesondere jene Schützen, die nahe an Dickungen postiert sind, werden als letzte zu ihren Ständen gehen. Dann steht der äußere Ring bereits und sofern Wild hoch gemacht wird, kann bereits Strecke gemacht werden. Beim Anstellen ist äußerste Ruhe zu wahren, kein Türen schlagen, kein Krach, keine Gespräche.
Genutzte Wechsel- Rückschlüsse ziehen, Stände verändern
Im Verlauf einer Jagd zeigt sich, ob die vermuteten Wechsel auch wirklich vom Wild genutzt werden. Ist dies nicht der Fall, sondern der unvermutete, kaum belaufene Wechsel 40 Meter weiter wird zur Flucht genutzt, so ist der Stand für folgende Jagden dahingehend neu auszurichten oder ein erweitertes Schussfeld zu schaffen. Auch gute Stände müssen regelmäßig verändert werden, um einem Gewöhnungs- und Meidungsverhalten des Wildes frühzeitig entgegen zu wirken.

Hundearbeit bei der Drückjagd

Nach jeder Jagd wird auch die Arbeit der Hunde auf den Prüfstand gestellt. Welche Hunde haben wirklich Flächenleistung gezeigt und das Wild sicher auf die Läufe und vor die Schützen gebracht? Auf Hunde, die am Erfolg nachweislich bestenfalls als „Füllmaterial“ beteiligt waren, kann bei nachfolgenden Jagden getrost verzichtet werden. Besser wenige, dafür aber gut arbeitende Hunde als riesige Meuten ohne wirklichen Nutzen. Als ideales Mittel zur objektiven Darstellung der individuellen Arbeit jedes Hundes hat sich das Ortungssystem Tracker herauskristallisiert. Passende Hunde für die Stöberjagd auf Rehwild sind insbesondere Jagdhunde mit gutem Laut und sicherem Fährtenwillen wie Teckel, Terrier, Bracken, und Wachtelhunde. Auf Schwarzwild eignen sich besonders sichtlaut jagende, wildscharfe Vorstehhunde, Terrier und Bracken
Drückjagdagdzeitpunkt- Deckungsfaktor
Der Zeitpunkt der Jagd ist für viele Reviere einer der Schlüsselfaktoren. Reviere mit wenig forstlichen Einständen verfügen in der Krautschicht über Einstände und Deckung bis zum ersten Frost. Farnhorste und weiteres Grün nutzt das Wild sehr gern. In diesen Revieren sollte die Drückjagd möglichst früh in der Saison durchgeführt werden. Ist die Deckung durch den Frost zusammengefallen, verlässt meist auch das Wild das betreffende Revier. Zu späte Drückjagdtermine können hier zum „geplanten“ Misserfolg führen.

Wetter am Drückjagdtag

Das Wetter des Drückjagdtages hat signifikanten Einfluss auf das Veralten des Wildes. Es lässt sich nicht beeinflussen, aber berücksichtigen. Durch die Aufzeichnungen werden zumindest Rückschlüsse gezogen, wie fest das Wild liegt oder welche Einstände bei welchen vorherrschenden Wetterlagen welches Wild präferiert. Die Berücksichtigung bei folgenden Bewegungsjagden kann zumindest kleine Nuancen der Verbesserung bieten. Bei eher schlechtem Wetter liegt das Wild häufig sehr fest. Die Hunde bekommen dementsprechend mehr Zeit für die intensive Stöberarbeit.
Gewichte erlegten Drückjagdwildes
Die Wildbretgewichte geben Aufschluss über den Gesundheitszustand des Wildes. Gesundes, agiles Wild von guter körperlicher Konstitution zeigt ein gutes Habitat mit angepasster Lebensraumnutzung durch das Wild sowie einen angepassten Wildbestand ohne innerartlichen Stress. So lassen Wildbretgewichte viele wichtige Rückschlüsse über die gesamte Wildbewirtschaftung zu. Weiterhin sind hierzu auch Wildschäden in Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen.

Unruhe im Revier, Kirrmaßnahmen/ Wildäcker und zugehörige Einstände

War es vor der Jagd im Revier besonders unruhig, ganz gleich wodurch, kann für folgende Drückjagden eine gezieltere Wildlenkung sinnhaft erscheinen. Wildäcker sind Magnete im Revier, in Einstandsnähe lenken sie das Wild gezielt, um es zielgerichtet und effektiv zu bejagen. Ebenfalls können gezielte Kirrungen im Wald vor der Drückjagd die Zeit- Raumnutzung des Wildes beeinflussen. Diese Möglichkeiten nutzen wir im Sinne einer effektiven und stressarmen Bejagung auf das uns anvertraute Wild.
Drückjagdzugewinndurch digitale Hundeortung
Insbesondere Notfälle sind weder zeitlich noch in Ihrer Örtlichkeit plan- oder absehbar. Über die rein „altmodische“ Planung und Organisation hinaus, ist der Einsatz von CB- Funk inzwischen längst etabliert, um die einzelnen Hundeführer oder Treibergruppen in verschiedenen Situationen individuell im Treiben zu steuern. Weiterhin ist dieser Zugewinn an Kommunikation ein Zugewinn an Sicherheit und Organisationspotenzial während der Drückjagd, wo andernfalls niemand in das Geschehen eingreifen kann. Bei kleinen Jagden ist auch bei all den zu bedenkenden Punkten eine einfache Organisation möglich. Sollen hingegen mehr als 30 Personen und Hunde zuverlässig koordiniert werden, stellt das zumeist eine große Herausforderung an die Vorarbeit. Insbesondere bei großen Drückjagden nutze ich das immense Potenzial der App sowie der Geräte bereits bei der Planung. Im Folgenden zeigen wir die technischen Möglichkeiten und daraus resultierende Veränderungen für die Drückjagd auf.
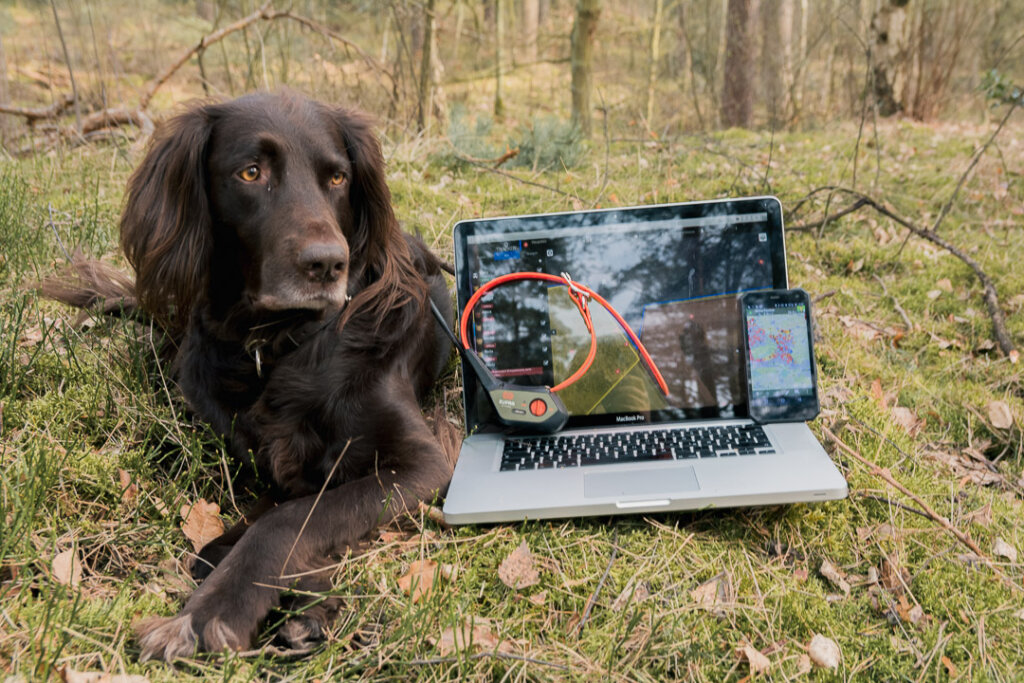
Schlüsselpositionen bei der Drückjagd: Der Jagdleiter

Wurde die Drückjagd im Vorfeld detailliert geplant, läuft alles von selbst. Das ist das Ziel des Jagdleiters für den Drückjagdtag. Eingriffe, an welcher Stelle der Drückjagd auch immer, sind Notfällen vorbehalten. Ein geplanter Selbstläufer der Extraklasse ist das Ziel.
Damit der Jagdleiter am Jagdtag höchstmögliche Kontrolle und wenig zu tun hat, um in Sonderfällen gezielt eingreifen zu können, werden Aufgaben delegiert. Persönlich hält er nur die Jagdleiterrede mit der Sicherheitsbelehrung und Freigabe.
Im Vorfeld werden die Ansteller eingewiesen, ebenso der Koordinator für die Jagdhundeführer. Eine andere Person wird die Jagdscheinkontrolle am Jagdtag direkt morgens bei Ankunft übernehmen. Diese Person wird zeitgleich die UVV- und Verhaltensregeln per Unterschrift anerkennen lassen. Weiterhin wird er delegieren, wer die Strecke der Anstellergruppen aufnimmt und diese an die Bergegruppen weitergibt. Ebenso wird festgelegt, wer den Aufbrech- und Streckenplatz koordiniert und wer dort hilft. Darüber hinaus wird er jemanden beauftragen, die Nachsuchenkoordination während der Streckenaufnahme durchzuführen.
Unverzichtbar: Der Ansteller bei der Drückjagd
Der Ansteller wird den Schützen seiner Gruppe bei Eintreffen am Sammelplatz zugewiesen. Ansteller müssen ortskundig sein! Idealerweise laufen Sie etwa eine Woche vor der Drückjagd mit dem Jagdleiter ihre Stände ab. Der Jagdleiter bespricht noch einmal sämtliche Besonderheiten und Sicherheitsbereiche mit den Anstellern vor Ort. Der Ansteller bekommt am Jagdtag seine Schützenliste sowie die Liste zur Drückjagdstreckenaufnahme an seinen Ständen nebst Band zur Anschussmarkierung sowie je nach Jagd auch Ohrmarken zur Wildzuordnung. Der Ansteller bringt jeden Schützen persönlich zu seinem Stand und weist ihn dort ein. Neben den Sicherheitsbereichen werden Triebrichtung, bekannte Wechsel, Einstände sowie Reviergrenzen und Standnachbarn bekannt gegeben. Jeder Schütze bleibt nach dem Treiben an seinem Stand und wird dort vom Ansteller abgeholt sowie die Strecke aufgenommen. Anschüsse markiert der Ansteller mit Einweisung des Schützen vom Stand aus. Eigenständige Nachsuchen werden niemals unternommen. Alles Wild wird zum Stand gezogen. Nur so können die Bergegruppen das Wild schnellstmöglich einsammeln.

Wenns auf der Drückjagd Eilt: Der zbV

zbV ist die Abkürzung für „zur besonderen Verfügung“. Diese Position des ZBV ist bereits bei kleinen Drückjagden sinnvoll, bei groß angelegten Bewegungsjagden obligatorisch. Der ZBV kann immer dann eingesetzt werden, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Ein Schütze fährt sich fest, ein Hund wird geschlagen und muss schnell zum Tierarzt, jemand hat einen Kreislaufzusammenbruch und ein Arzt muss schnell zum betreffenden Schützen gebracht werden. Alles Dinge, die vorkommen können, aber nie geplant eintreten. Der ZBV muss sich gut im Revier auskennen, er muss die Drückjagdstände und das gesamte zu bejagende Gebiet kennen und insbesondere Die Stand- und Revierkarte lesen können. Er hat nicht nur Telefonkontakt, sondern auch Funk und ist nötigenfalls mit jedem einzelnen vernetzt. Weisungen erhält er jedoch vom Jagdleiter oder einem Koordinationsbeauftragten. Damit er für alle Eventualitäten gerüstet ist und überall hinkommt, hat er neben einem Verbandskasten, Decken und Wasser ausreichend Licht an Bord seines großen, geländegängigen Allradfahrzeuges.
Der Treiber und Hundeeinsatz auf der Drückjagd
Neben der Reviergröße, der Revierstruktur sowie den zu bejagenden Wildarten und der Verkehrslage hat auch die Einstandsdichte einen Einfluss darauf, ob nur Treiber oder auch Hunden eingesetzt werden. Klassischerweise sollen die eingesetzten Drückjagdhunde auf das Schalenwild stöbern, es hochmachen, laut anjagen und vor die Schützen bringen.
Die Treiberwehr muss zwingend und auch im Sinne der Sicherheit in einer geraden Linie zusammenbleiben und die Dickungen systematisch durcharbeiten. Diese Koordination erfordert einen erfahrenen Treiberführer in der Mitte sowie gute Flügelmänner. Die gesamte Gruppe muss laut treiben und immer auf den Nebenmann achten, um Linie zu halten. Insbesondere in Dickungen und im unübersichtlichen Gelände kostet das nicht nur Nerven der Treiberführer, sondern auch Stimme. Eine Funkverbindung erleichtert die Koordination maßgeblich, doch ohne genaue Standorte zu kennen hilft auch manchmal keine Sprachverbindung. Je lang anhaltender das Schalenwild auf großer Fläche zeitgleich und anhaltend über das ganze Treiben hinweg beunruhigt wird, desto höher der Drückjagderfolg.

Hundeortung zur Drückjagdkoordination

Mit Hundeortungsapps wie Tracker sehen sich sämtliche Hundeführer einer Drückjagdgesellschaft in Echtzeit gegenseitig. Weiterhin auch sämtliche eingesetzten Hunde der Drückjagdgruppe. Sämtliche Nutzer sind hierdurch vernetzt, sodass jeder ständig über sämtliche Positionen und den Gesamtverlauf der Drückjagd informiert ist. Der Treiberführer kann bei Abweichungen einzelner Hundeführer oder Treiber in der Gruppe sofort gezielt korrigierend eingreifen. Hierfür eignet sich als Ergänzung Funk am besten.
Der Hundeeinsatz bei der Drückjagd auf Schwarzwild
Eine Drückjagd erfordert gute, leistungsstarke Hunde. Die Leistung der Jagdhunde für den Drückjagdeinsatz objektiv zu bewerten ist nicht einfach. Meute, Solojäger oder Standschnaller?
Die richtige Anzahl an brauchbaren Hunden, die eingesetzt werden, ist maßgeblich für den Drückjagderfolg verantwortlich. Welche Hunde sollen es im Idealfall sein? Nur Solojäger? Vom Stand geschnallte Stöberhunde oder sollte eine Meute eingesetzt werden?
Fragen mit endlosen subjektiven Diskussionen, zu denen jeder seine eigene Meinung hat. Wer ist schon in der Lage, die Arbeit eines Hundes zu beurteilen, der sich zwar schnell ins Treiben schlägt, nach etwa einer Stunde zurückkehrt, ob dieser eine effektive Stöberleistung erbracht hat. Oder dass die kopfstarke Hundemeute eine effektive Flächenleistung zur Drückjagd beitrug? War der vom Stand geschnallte Hund nicht doch waidlaut? Oder hat er wirklich seinem Führer Wild zugetrieben? In der Praxis beobachte ich oft einen Hang vom Fährtenlaut zum Waidlaut und präferiere daher persönlich den sichtlauten Hund.

Die Bewertung der Hundearbeit
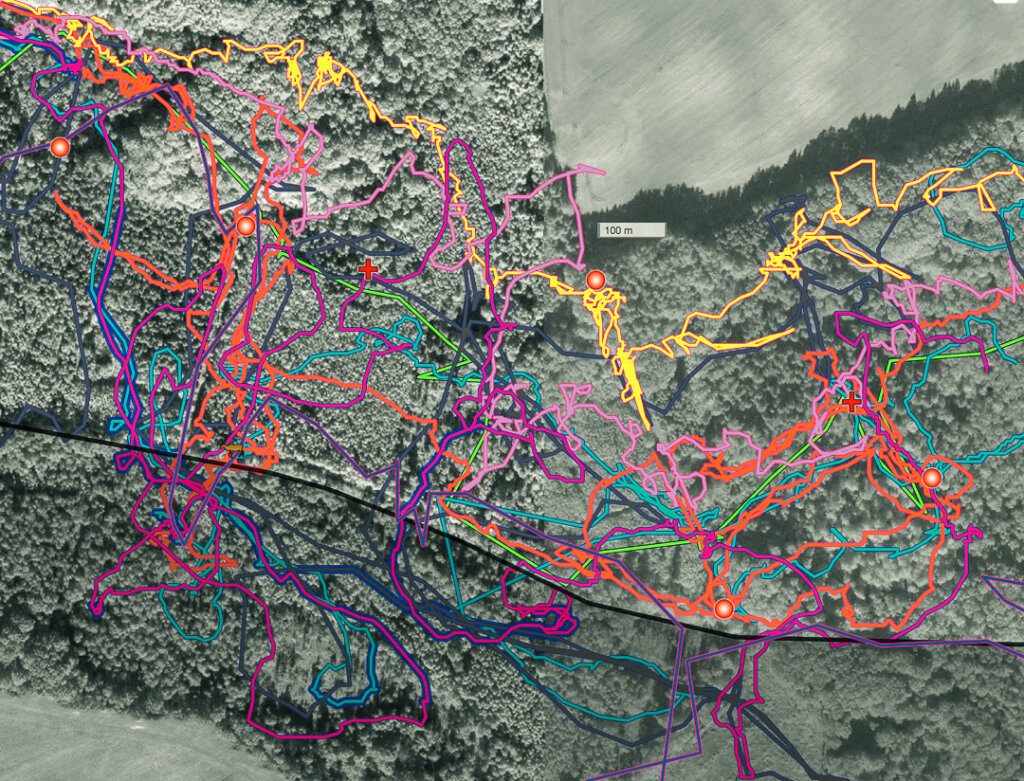
Die Firma Tracker aus Finnland stellt Hundeortungsgeräte der Referenzklasse her. Diese Geräte nutze ich seit ca. 2014. Bereits, seitdem stellten die Geräte in mehreren meiner Tests für das Jäger- und Sauenmagazin sowie in Filmbeiträgen auf Jäger Prime unter Beweis, dass sie zuverlässig funktionieren. Neben der zuverlässigen, reichweitenunabhängigen Hundeortung bieten diese Geräte mit zugehöriger App einen sehr umfangreichen Zusatznutzen. So unter vielen anderen die Wiedergabe der Jagd. Durch diese Möglichkeit, die gesamte Drückjagd noch einmal Revue im Büro ablaufen zu lassen, kann nachträglich im Zusammenspiel mit den Beobachtungen der Jagd eine klare Bewertung der Hundearbeit jedes einzelnen Hundes sowie der Treibergruppen erfolgen. Ebenso gewinnt der Jagdleiter im Nachgang wertvolle Informationen über Wildbewegungen, um künftige Jagden entsprechend zu optimieren. Noch interessanter wird es, wenn möglichst viele, im Idealfall alle Hunde mit Trackerhalsbändern geführt werden. Nur hierdurch können im direkten Vergleich klare Rückschlüsse über die Arbeitsweise und die objektive Leistung einzelner Hunde gezogen werden.
Hundearbeit auf dem Prüfstand
In einer ganzen drückjagdsaison habe ich 15 jagende Hunde auf zahlreichen Jagden mit dem Tracker System ausgestattet. Zum einen, um die Leistung und Praktikabilität zu prüfen, zum anderen, um Rückschlüsse über die Hundearbeit zu erhalten. So wurden auch drei der Drückjagden für "Unterwegs mit den Profis" auf Jägerprime verfilmt.
Verschiedene Reviere benötigen wegen ihrer differenten Bejagungsvoraussetzungen angepasst, unterschiedlich arbeitende Hunde. Vom kurzjagenden Stöberhund für kleinste Dickungen über die weit jagenden und raumgreifenden kontinentalen Vorstehhunde wie Drahthaar, Langhaar oder Kurzhaar bis hin zu eingeschworenen Meuten, die in dichten Schwarzdorn und Brombeerverhauen auf kleinster Fläche einen hohen Druck auf die Schwarzborstler aufbauen, um sie auf die Läufe zu bringen.
Die gewonnen Datensätze erlauben exakte Rückschlüsse über sämtliche Laufwege und Arbeitsweisen. Weiterhin wird der Laut der Hunde objektiv erfasst. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten und vor allem die effektive Flächenleistung der Hunde werden im Nachgang betrachtet. Einzelne Hunde und ihre Arbeitsweise können so in Relation gestellt werden.

Klassische Auswertung über die Hundearbeit bei der Drückjagd

Einfach gedacht stellt sich bei der Datenbetrachtung jedoch schnell die Frage nach dem Standard, der als normales Mittelmaß angenommen wird. Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Dafür sind die Arbeitsweisen der unterschiedlich jagenden Hunde in sämtlichen Punkten zu different. Alle Drückjagdtreiben wurden, um identische Bedingungen vorzufinden, in sich einander weitestgehend gleichenden Revieren durchgeführt.
Früher wurden sämtliche Informationen zum Drückjagdverlauf von den verschiedenen an der Jagd Beteiligten dem Jagdleiter mündlich mitgeteilt. Dieser zog Rückschlüsse aus der subjektiv empfundenen Hundearbeit, den Treiben und den möglichen Wechseln des Wildes. Leider sind derlei Beobachtungen nur allzu oft viel zu subjektiv und dadurch nicht hilfreich. Natürlich sind auch die herkömmlichen Informationen und Beobachtungen nach wie vor elementar wichtig, jedoch müssen Sie heute zutage nicht mehr unreflektiert genutzt werden, sondern können um objektive Daten ergänzt werden.
Moderne Auswertung über die Hundearbeit
Die Nutzung von Tracker bietet den enormen Zusatznutzen. Nach der Jagd kann das gesamte Jagdgeschehen der Drückjagd am Computer in frei wählbarer Geschwindigkeit angesehen werden. Wie ein Film. Sämtliche Bewegungsmuster der Hunde und Hundeführer mit der Tracker App werden dargestellt. Orte, an denen Hunde laut gaben inklusive der Belllautfrquenz, die Geschwindigkeiten sowie der Netzempfang werden visuell und in Zahlen dargestellt. Eine Auswertung und ein Übereinanderlegen mit den klassischen Beobachtungen der Schützen, Treiber und Hundeführer ist allumfassend möglich.
Rückschlüsse aus den Beobachtungen, die mithilfe der App untermauert werden, sind für künftige Drückjagden im selben Gebiet von großem Wert. Hieraus werden Einstandskarten und möglicherweise neue Fluchtwechsel erkannt und bei der Planung neuer Stände berücksichtigt.
Bei der Drückjagd gilt es ständig das Sichtbare zu nutzen und die Jagd ständig zu verbessern, denn eine effektivere Jagd heißt auch eine störungsärmere Jagd!

Hundearbeit bei der Drückjagd auf den Prüfstand

Die Aufnahmen der Drückjagden zeigen, dass bei weitem nicht alle Hunde einer Meute eine echte Jagdleistung erbringen. Bei einer Jagd jagten von 8 Hunden im wesentlichen lediglich 3, um Wild aufzustöbern. Alle anderen umkreisten nahezu ausnahmslos dicht gedrängt im näheren Umfeld den Führer. Sogar so dicht, dass für viele Minuten vier Hunde nur wie ein Hund auf der Karte aussahen. Diese Hunde unterstützen kurzzeitig die anderen, sofern diese nicht zu weit entfernt waren, um deren Laut zu vernehmen. Die effektiv sehr geringe Flächenleistung je einzelnem Meutehunde resultiert aus dem hohen Anteil nur mitlaufender, statt aktiv stöbernder Hunde. Das verdeutlichen insbesondere auch die Laufwege auf der Karte im Nachgang. Resümierend ist hier eine Überbesetzung mit Hunden gegeben, die effektiv gar nicht notwendig wäre und die keine Mehrleistung zur Drückjagd beiträgt.
In unseren Aufzeichnungen arbeiteten die vom Stand geschnallten Stöberhunde alle sehr standnah und lösten sich nur gelegentlich vom Stand. Dieser wurde jedoch regelmäßig wieder aufgesucht. Keiner der Standschnaller jagte weiträumig, die Flächenleistung lag daher im untersten Bereich. Ob es an der Einarbeitung oder den Hunden individuell lag, kann ich nicht verifizieren.
Pro und Kontra Vorstehhund auf der Drückjagd
Insbesondere große Vorstehhunde sind aufgrund ihrer Geschwindigkeit auf einigen Drückjagd unbeliebt und verpönt. Oft bringen sie das Wild sehr schnell oder sogar zu schnell vor die Standschützen. Die Solöjäger zeigten mit ihrer sehr hohen Flächenleistung nicht nur, wie viel Dampf sie haben; Sie bewiesen in erster Linie die enorme Einzelleistung jedes Solojägers. Durch den Bezug zum im Treiben begleitenden Hundeführer wird der Hund durch die Führerbindung gesteuert und kann eine sehr große Fläche allein und höchst effektiv wie auch schnell nach Wild durchstöbern. Im Falle von krankem Wild hat der kräftige, hochläufige Vorstehhund einige Vorteile. Die einzeln geführten kleineren Rassen wie Terrier wiesen jedoch ähnliche Leistungen auf.

Wie viele Hunde werden bei einer Drückjagd benötigt?

Aufgrund der ausgewerteten Drückjagden können wir Aussagen zur Anzahl notwendiger Hunde je Hektar Einstands- und Dickungsbereich treffen.
Standschnaller: min.1 Hund je ca. 5 ha Dickungs- und Einstandsbereich
Solojäger: min. 1 Hund je 10 ha Dickungs- und Einstandsbereich. Es sollten mindestens zwei, besser drei Hunde in einem Gebiet zum Einsatz kommen, um sich gegebenenfalls gegenseitig unterstützen zu können.
Die effektivste Bejagungsstrategie bewiesen kleine Gruppen mit 3- 5 Solojägern, die gebietsweise platziert werden, um die hohe Flächenleistung zu liefern.
Da die Hundemeute auf der Drückjagd zu einem Großteil eher kleinräumig jagt, sollten die Meuten meiner Meinung nach ausschließlich in dichten Bereichen eingesetzt werden, um ihre Leistung der Gruppe abrufen zu können. Unsere Auswertungen zeigen, dass die Meute als Gruppe etwa 40 ha Dickungs- und Einstandsbereich durchjagen kann.
Diese Anhaltswerte werden je nach Revierbeschaffenheit- Dickungsstruktur, Relief, Feuchtigkeit, Begehbarkeit und Wildvorkommen entsprechend angepasst.
Die Hunde arbeiten lassen
Die ausgewerteten Drückjagden verdeutlichen auch, dass teilweise Führer oder Jagdleitungsfehler zu geringerem Erfolg führen können. Halten sich ein oder mehrere Hunde auf kleiner Fläche auf und arbeiten dort intensiv, so sollte die Treiberwehr genau dort unterstützen oder zumindest warten und die Hunde arbeiten lassen. Einfaches, Zeitplan entsprechendes Weitertreiben und die Hunde allein lassen oder später einsammeln ist in dieser Situation äußerst kontraproduktiv. Die Hunde wissen oft besser als wir, wo es sich lohnt, intensiver zu arbeiten und wo sich eventuell noch ein Stück wild drückt, oder gar der Keiler versucht sich überlaufen zu lassen.

Meute, Standschnaller oder Hundeführer mit solojagenden Hunden für die Drückjagd
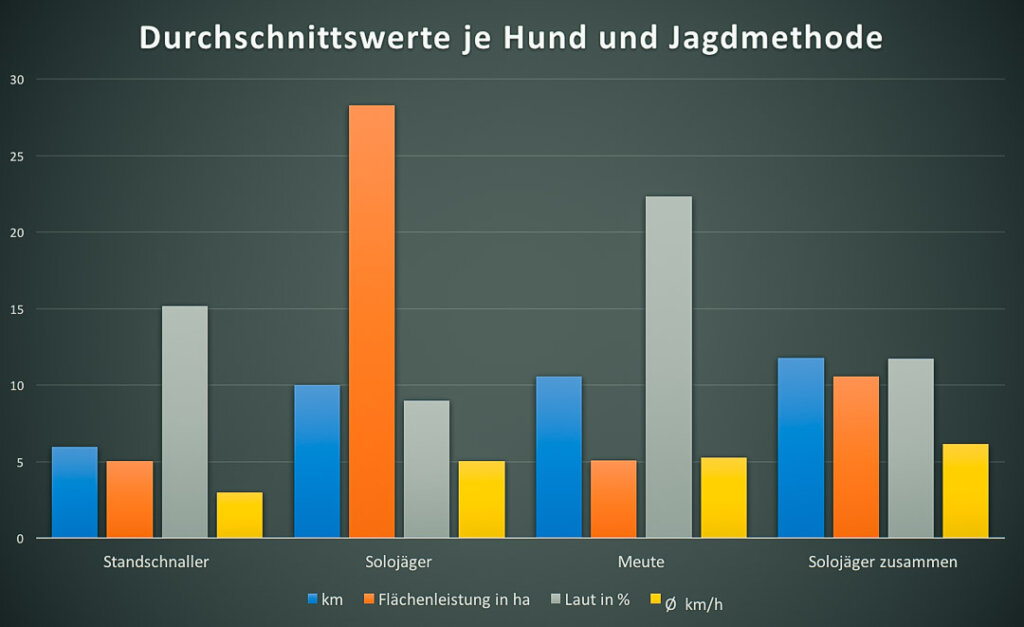
Alle drei Varianten können je nach Gegebenheit der Drückjagd sinnvoll eingesetzt werden. Standschnaller setzen zumeist Stöberhunde ein. Sie werden oft als mitjagende Standschützen in oder nahe an Einständen eingesetzt. Diese Standschnaller können, sofern sie auf ganzer Fläche verteilt sind, auf Reh- und Rotwild eingesetzt werden. Soll auch Schwarzwild bejagt werden, funktioniert das System hingegen nicht. Die einzelnen Hunde der Standschnaller bauen auf das sich im Kessel drückende Schwarzwild zu wenig Druck auf. Für die Drückjagd auf Reh- und Rotwild hingegen beunruhigen diese Hunde meist auf ganzer Fläche mit geringem Druck, der das Wild gemäßigt vor die schützen bringt. Der große Nachteil liegt hierbei jedoch auf einer oft geringen Flächenleistung der Hunde, die nicht selten nur in einem engen Radius um den Stand herum arbeiten. Oder das komplette Gegenteil darstellen und zunächst viel Strecke machen und dann nicht bogenrein jagen und irgendwann mit Glück zurückkehren.
Die Hundemeute bei der Drückjagd
Die eingesetzten Meuten unserer Jagden bestanden aus mindestens 5 und maximal 10 Hunden. Die Hunde aller Meuten jagen stets zusammen und sind allesamt erfahren und gut bejagt. Die meisten der getesteten Meuten sind der Meinung, der Hund müsse den Kontakt zum Führer suchen und dafür braucht es keine Technik. Tatsächlich suchten die Hunde regelmäßig den Kontakt, deshalb setzten diese Meuteführer normalerweise auf der Drückjagd keine Ortungstechnik ein.
Die vier Test- Drückjagdmeuten erreichten Flächenleistungen von 37- 49 ha. Hierfür liefen sämtliche Hunde der unterschiedlichen Meuten und Einsätze in Summe addiert zwischen 49 und 112 km pro Drückjagdtag. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 5,3 km/h und ist hierdurch im oberen Drittel angesiedelt. Auffällig ist der sehr hohe Anteil der Strecken, auf denen die Hunde laut gegeben haben. Dieser Anteil ist mit rund 22 % überdurchschnittlich hoch, was wohl daran liegt, dass so bald einer der Hunde Laut gibt nahezu alle anderen ebenfalls Laut geben.
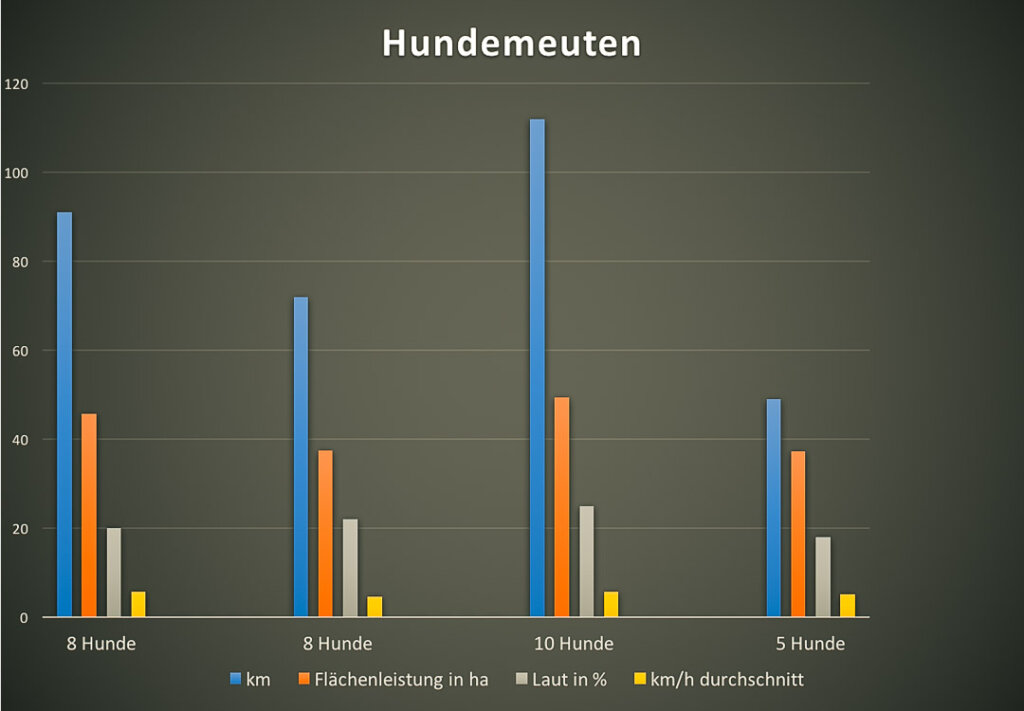
Hundemeute ohne GPS auf der Drückjagd?

Einige Meuteführer verzichten bei der Drückjagd komplett auf Ortungsgeräte. Werden diese tatsächlich nicht benötigt, weil die Hunde eine höhere Bindung zu ihrem Meuteführer haben oder haben einige vielleicht Angst davor zu sehen und es öffentlich abgefragt zu bekommen, wie effektiv sie jagen? Einige Meuteführer rufen schließlich hohe Tagessätze auf, die einige Jagdleiter vielleicht nicht zu zahlen bereit wären, wenn sie wüssten, dass keineswegs alle Hunde effektiv jagen.
Da ist die Drückjagdmeute richtig!
Drückjagdmeuten haben ihre eingeschränkte Berechtigung in extremen Dickungskomplexen. Sie haben eine geringe Flächenleistung, welche durch zwei oder drei weiter jagende Meutehunde gesteigert werden kann. Die Meute kommt auf Schwarzwild zum Einsatz, dass sich nicht ohne Nachdruck zum Verlassen der Dickung bewegen lässt. Rehwild oder Rotwild hingegen sind nicht die Zielarten der drückjagdmeute. Insbesondere Rotwild wird zu schnell angehetzt und verlässt das Treiben schnell und weiträumig. Rehwild wird häufig von der Meute gegriffen, was ebenfalls nicht Sinn der Sache ist. Das Einsatzspektrum der Hundemeute muss insbesondere auf der Drückjagd wohlüberlegt sein. Die geringe Flächenleistung berücksichtigt, ist der Einsatz nur punktuell sinnvoll. Diese geringe Flächenleistung ist das Resultat aus der Zusammenstellung einer Meute. Zumeist gibt es einen weiterjagenden Finder oder Kopfhund und alle anderen Meutemitglieder. Diese anderen schlagen sich bei, sobald der Finder Wild gefunden hat. Oft fangen diese Meuten mehr Wild, als dass sie einen positiven Effekt auf die Drückjagd haben.

Nicht erwünschte Meuten

Meuten, in denen ungeprüfte, nicht als Jagdhund anerkannte Rassen geführt werden, die womöglich noch stumm jagen und meistens gesundes Wild stellen, hetzen, fangen und abtun erfüllen vielfach den Tatbestand der verbotenen Hetzjagd. Ihr Einsatz ist unbedingt zu unterlassen! Die Aufgabe der Hunde, Hundeführer oder der Meute auf der Drückjagd ist nicht das Beutemachen selbst, sondern das in Bewegung bringen!
Der Standschnaller
Die gut eingejagten Stöberhunde, welche vom Stand auf der Drückjagd geschnallt wurden, bejagten Flächen von 3,4 bis 7,1 ha. Der Laufaufwand hierfür war in Relation gering, was in der kleinräumigen Arbeitsweise begründet ist. Den hohen Lautanteil von maximal 25 % schreibe ich der spurlauten Arbeit vieler Stöberhunde zu. Möglicherweise überschritten einige der Hunde die Grenze zum Waidlaut. Das kann ohne genauere Beobachtungen jedoch nicht sicher verifiziert werden.
Die durchschnittlichen Geschwindigkeiten der Stöberhunde lagen mit 3,0 km/h im unteren Bereich.
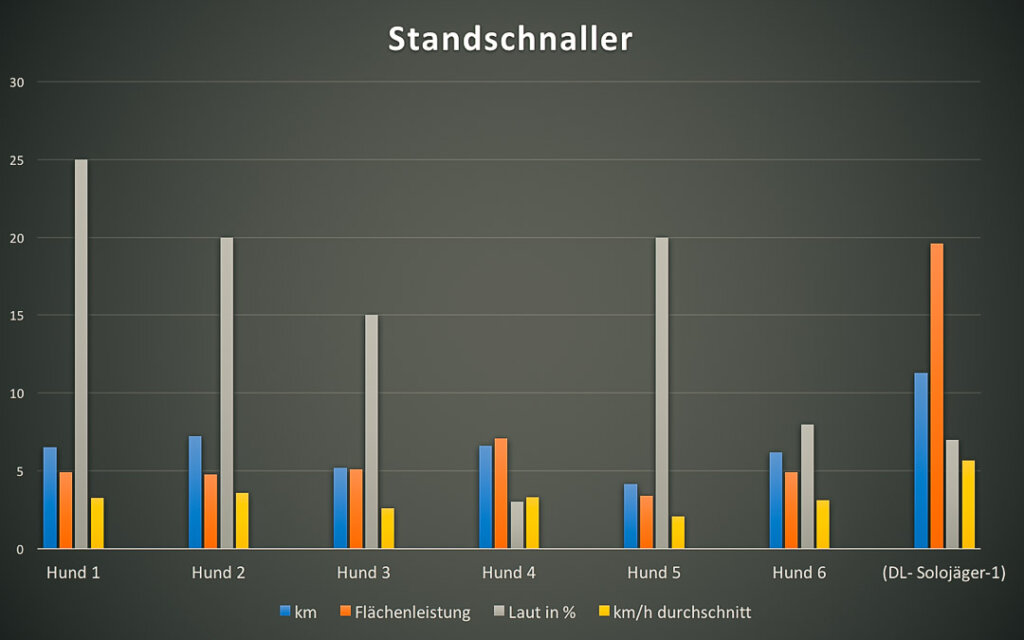
Solojäger auf der Drückjagd
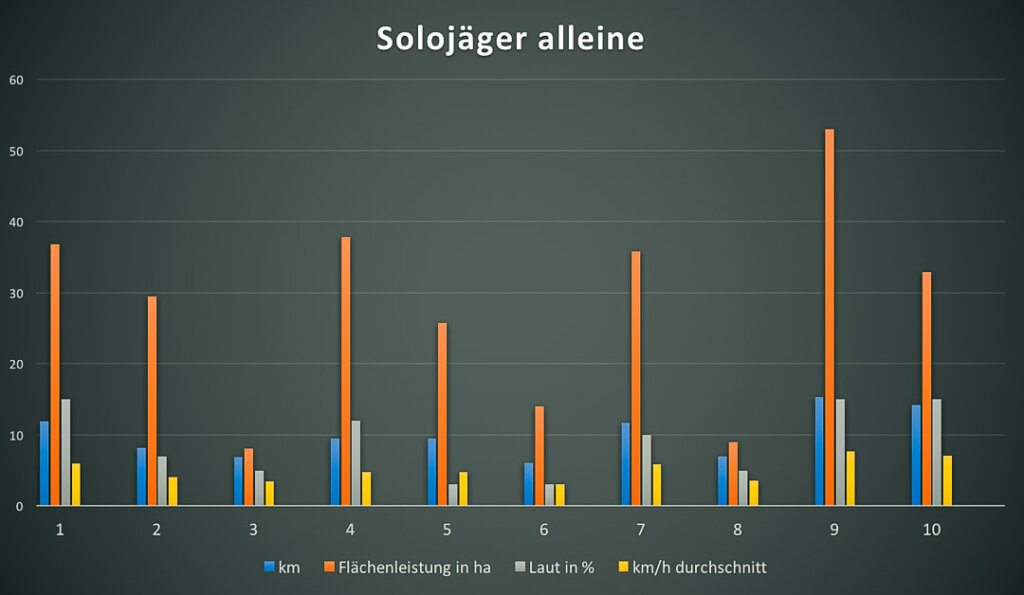
Solo eingejagte und alleinjagende Hunde, bei unseren Jagden fast ausnahmslos Vorstehhunde, erlangten für sich allein betrachtet die höchsten Werte der effektiven Flächenleistungen der Drückjagden.
Diese lagen je Hund im Durchschnitt bei 28,3 ha! Der Spitzenreiter mit 53 ha zeigte, wie viel Dampf er hat! Ein im unteren Bereich der Flächenleistung liegender Spaniel durchstöberte 8,1 ha kleinsträumig und effektiv nahezu komplett.
Zwischen sechs und vierzehn Kilometer liefen die Hunde für diese Stöberarbeit. Als jagdlich effektive Flächenleistungen liefen die Hunde zwischen sechs und 10 Kilometern.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Solojäger lag mit 5,0 km/h etwas unterhalb der Meutegeschwindigkeit.
Der Lautanteil liegt mit 9 % im Normalbereich, da jeder Hund nur für sich jagte und Laut gab, sofern er fährten- oder Sichtlaut an Wild kam.
Etwaige Waidlaut agierende Hunde werden aufgrund der Belllautsensoren der Halsbänder schnell identifiziert und aussortiert. Auf unseren Drückjagden kamen keine waidlaut jagenden Hunde vor.
Solojäger im Drückjagdteam
Bilden eine überdurchschnittlich effektiv arbeitende Gruppe, weil jeder Hund für sich allein durch seinen Finderwillen bereits eine sehr hohe Drückjagd- Flächenleistung erbringt. Durch eine Kombination aus kurz- Mittel- und weitjagenden Hunden wird die Fläche in optimaler Weise absolut feinrasterig abgedeckt und nach Wild durchstöbert. Findet ein Vorstehhund krankes Wild, oder kommt es zu sich stellendem Wild oder zu Sauen, die sich im Kessel drücken, finden sich einzeln eingearbeitete Hunde schnell zu einer höchst effektiven Gruppe zusammen. Unmittelbar nach dem Sprengen der Rotte trennen sie sich schnell wieder, um allein weiterzuarbeiten. Immer wieder arbeiten in dichten Bereichen zwei oder mehr Hunde locker, aber effektiv und scharf zusammen. Die Solojäger zeigen keinerlei Abhängigkeiten, wie es etwa bei den Meuten der Fall ist.
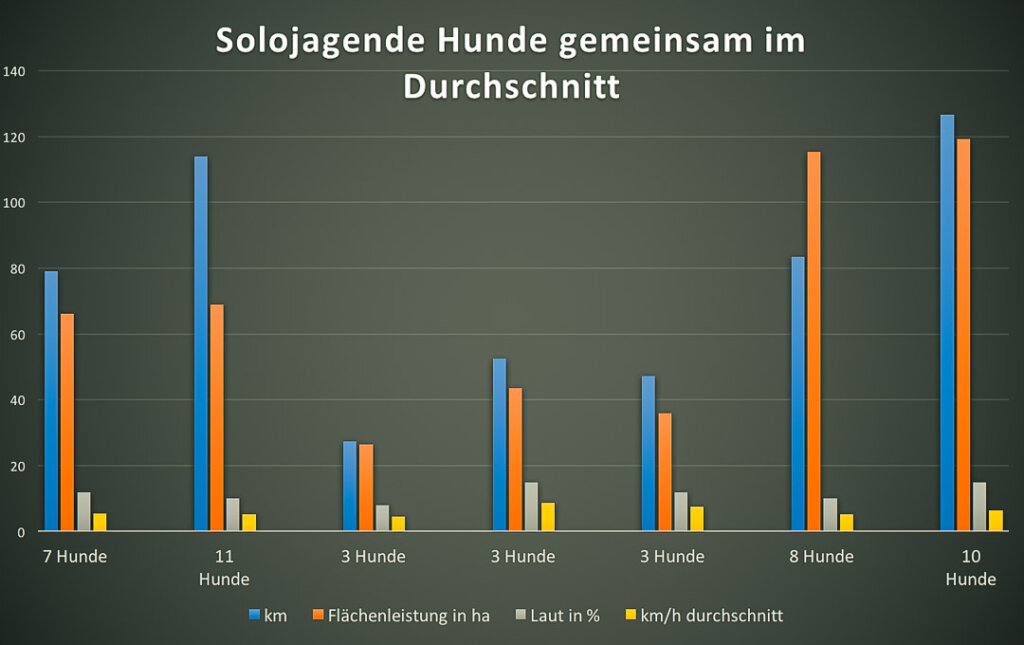
Solojäger vom Drückjagdstand geschnallt- geht das?

Liegt die geringe Flächenleistung der vom Stand geschnallten Stöberhunde möglicherweise an ihrer anderen Art der Einarbeitung? Ein Versuch gibt Aufschluss. Ich schnallte meine ansonsten ausschließlich mit mir im Treiben arbeitende DL-Hündin erstmals vom Stand.
Zunächst verstand der Hund nicht, warum es nun unter den Sitz geht und warum sie sich dort zunächst eine Viertelstunde warten sollte. Der „Voran- Befehl “ brachte nur skeptische Blicke. Durch etwas aufmuntern ging es schließlich doch „voran“. Zunächst noch sehr kleinräumig in einem Radius von unter fünfzig Metern. Nach und nach erweiterte sich der Stöberradius, bevor letzten Endes Dickungen mit potenziellem Wildvorkommen in einem etwa ein Kilometer Radius abgearbeitet wurden. Die Flächenleistung dieser Jagd mit 20 ha zeigt ein hohes Leistungsniveau.
Ähnliche Leistungen (36,8 ha) zeigt der Hund auch als Solojäger auf der Drückjagd. Der Versuch lässt den Schluss zu, dass einzeln eingearbeitete und bejagte Hunde nicht nur weiträumiger, sondern auch eigenständiger nach Wild stöbern.
Angepasster Drückjagdhundeeinsatz
Der Einsatz einer dem Treiben angepassten Anzahl einzeln eingejagter Hunde unterschiedlicher Führer ist für Drück- und Bewegungsjagden die organisatorisch beste Variante.
Die sehr hohen Flächenleistungen rein führerbezogenen Solojäger leisten diese auch im Zusammenschluss zu einer Gruppe. Die Leistung lag dann zwischen 26 ha mit drei Hunden und als Spitzenwert bei 119,1 ha mit zehn Hunden. Im Verhältnis zur Meute benötigen die Hunde für diese Leistung nur unwesentlich mehr Laufaufwand. Weil jeder Hund selbstständig eine enorme Flächenleistung bereits allein erbringt und auch genauso eingearbeitet ist, sind keine Hunde dabei, die nicht effektiv stöbern oder nahezu unnütz umherlaufen. Die effektive Flächenleistung ist mit zusammengeschlossenen, einzeln jagenden Hunden geringfügig niedriger, als es jeder Hund für sich zu leisten vermag. Das liegt jedoch allein an den zwangsweisen entstehenden Überschneidungen der bejagten Flächen.
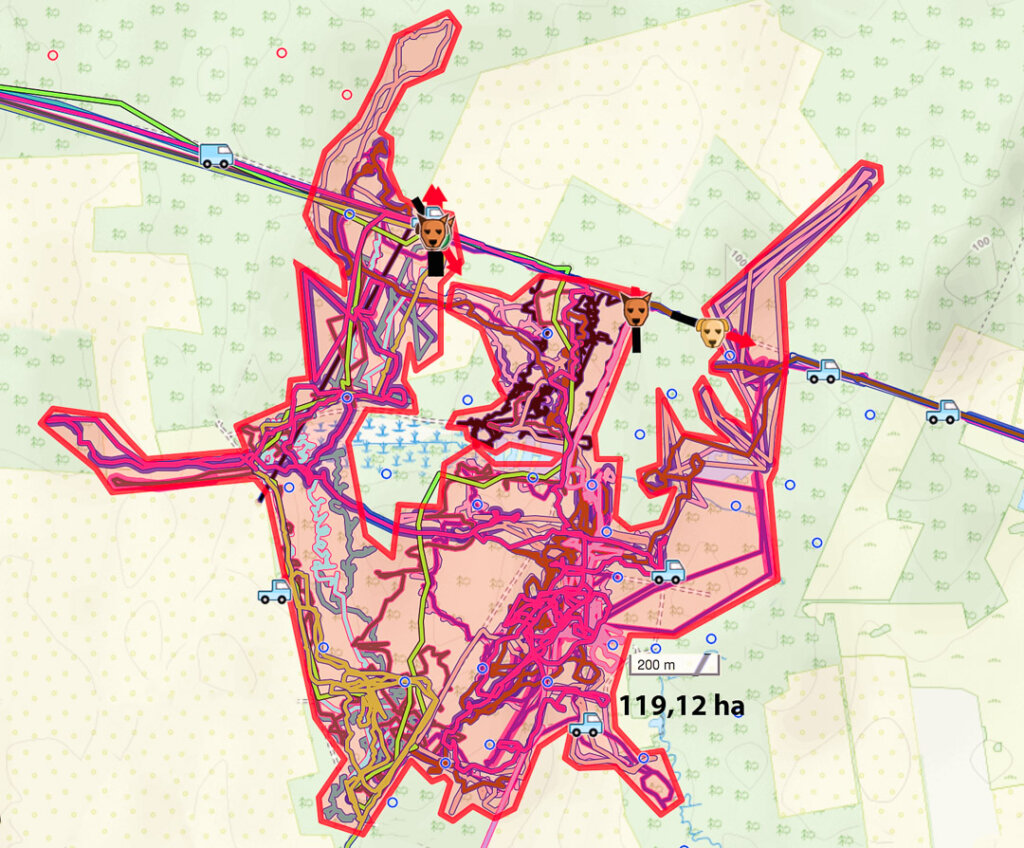
Große Treiberwehr oder Kleine Hundeführer Gruppe bei der Drückjagd?

Erfahrungsgemäß haben zusammengeschlossene Treiberwehren aus Hundeführern mit ein oder zwei solojagenden Hunden die größte Flächenleistung. Das liegt im Wesentlichen daran, dass jeder Hund für sich allein eingejagt ist und Führerbezug sowie Orientierungsvermögen beweist. Die Hunde suchen Einstandsbereiche und Dickungen mit Wildvorkommen selbstständig auf. Wenn ein Hund auf Wild stößt, schlagen sich schnell weitere Solojäger bei und bauen auch bei Schwarzwild den notwendigen Druck auf. Nach dem Anhetzen trennen sich die Solojäger in ihrer erlernten Manier schnell wieder, um weiträumig einzeln weiter zu jagen. Erfahrungsgemäß ist dies meine präferierte Art, mit Hunden auf der Drückjagd zu arbeiten. Junge Hunde, die noch eingearbeitet werden müssen, sollten ausschließlich in kleinen zwei bis 5 Mann starken Gruppen mit einem kurzjagenden Hund beigeordnet werden. So kann der Hundeführer in Absprache etwas losgelöst auch bei seinem Hund sein und den wichtigen Führerbezug nachhaltig aufbauen. Hierfür ist nicht jede Jagd geeignet.
Große Treibergruppe und junge Hunde für die Drückjagd?
Werden in der großen Treiberwehr bei der Drückjagd Hundeführer eingesetzt, müssen diese Hundeführer zwingend ihren Platz in der Treiberwehr einhalten. Hierdurch kann es zu Problemen kommen, da der Hund nicht immer sicher beim Hundeführer bleibt, sondern dort jagt, wo das Wild ist. So schließen sich nicht selten Hunde zusammen und jagen dort, wo etwas los ist. Stellt sich dort Wild, fehlt oft Hilfe durch den Hundeführer, wodurch Hunde gefährdet werden. Hierdurch leidet jedoch insbesondere bei jungen Hunden die Bindung zum Hundeführer. Ganz besonders, wenn der Hund mit fremden Hundeführern oder Treibern Beute macht, was in insbesondere während der Einarbeitung zwingend zu vermeiden ist. Durch solche Fehlverknüpfungen entwickeln sich schnell fernaufklärende, weitjagende Hunde, die sich beliebig auch anderen Treibern beischlagen und hierdurch die Führerbindung nachhaltig verlieren.

Die erfahrene Drückjagd- Treiberwehr

Sind überall erfahrene Hundeführer im Treiben, die schnell eingreifen können, wenn sich Sauen stellen oder Hunde geschlagen werden, ist das ein fachpraktisch sehr guter Weg. So wissen insbesondere die Hunde diese Unterstützung und den Verlass auf den Hundeführer zu schätzen. Weiterhin ist hierdurch sichergestellt, dass kranke, sich einschiebende Sauen gestellt und tierschutzkonform abgefangen werden. Somit kann auch manche, ansonsten anfallende Nachsuche bereits im Treiben erledigt werden. Einen etwaigen Fangschuss oder das Abfangen obliegt ausschließlich den Hundeführern! Aus diesen Gesichtspunkten heraus ist es sinnhaft, kleine Treibergruppen mit mindestens sichtlauten Hunden in Bereichen einzusetzen, in denen sich das Wild drückt. Der Einsatz der Hunde ist abhängig von der Zielart der Drückjagd.
Große Treiberwehr mit Solojägern, kleine Treibergruppe mit Solojägern
Drückjagdreviere mit kleinen und auch größeren Einstandkomplexen auf der ganzen Fläche sind ideal für mehrere größere Treiberwehren mit solojagenden Hunden. Weißt ein Treiben hingegen nur versprengt Einstände auf, welche immer wieder durch größere Freiflächen oder Altholzbestände voneinander getrennt sind, so ist jenes Treiben prädestiniert für kleine, mindestens zwei (Aufgrund des Gefahrenpotenzials) bis möglichst nicht mehr als zehn Mann starke und durch etwa 1-6 Hunde unterstützte „Beunruhigungsgruppen“. Diesen Mini-Treibergruppen werden Einstandsbereiche zugeordnet und beginnen sofort mit den Bereichen des Einstandes, in denen erfahrungsgemäß das Wild steckt. So werden insbesondere frühzeitig Sauen auf die Läufe gebracht. Alsdann kann die Kleine Treibergruppe mit ihren Hunden die restlichen Einstände systematisch abarbeiten. Die der Gruppe zugeordneten Komplexe können fortan flexibel, so wie es individuell notwendig ist, die gesamte Dauer des Treibens über beunruhigt werden. Das Wild im Einstand wird herausgetrieben und sich von außen, erneut einwechselndes Wild, wird sofort wieder auf die Läufe gebracht.

Das Zusammenspiel machts‘

Die Gruppe bleibt mit ihren Hunden das gesamte Drückjagd- Treiben über im Einstand, die Hunde kehren kurz nach dem das Wild den Einstand verlassen hat, zurück. So können auf Dauer effektive Gruppen gebildet werden. Fernwechsel werden bei dieser Art einer Drückjagd in idealer Weise mit Schützen abgestellt. Sofern es primär um Rot- und oder Rehwild geht, reicht meist ein kurz jagender Hund, gern beispielsweise ein Teckel oder Terrier, die nur wenig angemessenen Druck auf das Wild machen. Insbesondere lautjagende Teckel sind dort, wo es das Gelände zulässt, ideal für die Stöberjagd auf Reh- und Rotwild. Das Wild kann den laut jagenden Hund orten und sieht ihn nicht als direkte Gefahr. So wird das Wild in der Regel viel ruhiger vor die Schützen gebracht. Es verhofft öfter uns sichert zum Hund zurück, was durch zusammenbleibende Familienverbände ein sicheres Ansprechen und Zuordnen sowie oft auch ein Schießen auf stehendes Wild ermöglicht.
Achtung Erschöpfung der Hunde während der Drückjagd
Die Anzahl der Hunde wird, an die Größe der Einstände angepasst. Sollen beispielsweise zwei gut eingejagte Jagdhunde einen wildreichen Einstand mit rund 10 ha allein beunruhigen, laufen sie oft mit dem Wild im Kreis und bereits nach kurzer Zeit sind die Hunde erschöpft. Bei der Anzahl der Hunde gilt für mich als Berufsjäger immer: Lieber wenige und gut sowie scharf und solo eingejagte Hunde als zu viele, die nur wie Kometen und ohne Schärfe um den Hundeführer herumlaufen. Dennoch müssen auch gute Solojäger in dichten Einstandsbereichen oder für lange Treiben oder schweres Gelände zahlenmäßig unterstützt werden, wenn sie nicht bis zur völligen Erschöpfung jagen sollen. Diese Erschöpfung der Hunde ist insbesondere am Schwarzwild gefährlich, da sie besonders gefährdet sind, geschlagen zu werden. Durch die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Hunde auf der Drückjagd können die Hunde die Schwarzwildrotten sicher sprengen, sodass den Schützen einzelne, gut ansprech- und beschießbare Sauen kommen.

Die richtige Hundeführer- Hunde Kombination für die Drückjagd

Passionierte Hundeführer mit guten, scharf jagenden Solojägern, die mit Erfahrung, Anstand, handwerklichem Können und Jagdmoral arbeiten sowie einen besonnenen Umgang mit der Waffe pflegen und bei denen die Hundearbeit an erster Stelle stehen, sind die Grundlage erfolgreicher Drückjagden. Doch genau diese Leute brauchen entsprechend viele Drückjagdeinsätze für die Einarbeitung ihrer Hunde uns sind dann sehr gefragt. In diesem Zusammenhang sei auf die VstP, die Verbandsstöberprüfung des JGHV hingewiesen. Die Stöberprüfung ist für solojagende Hunde eine praxisgerechte und aussagestarke Prüfung für den Drückjagdeinsatz.
Einige Rassen bringen typische Eigenschaften für die Drückjagd mit. Doch auch individuelle Ausprägungen der Art des Jagens, des Lautes und des Finderwillens sind elementar für die Auswahl der richtigen Hunde. So sind die Wildschärfe am Schwarzwild ohne Selbstgefährdung, der unablässige Finderwille, ein sicherer Fährten- oder Sichtlaut, ein gutes Orientierungsvermögen mit hoher Führigkeit und Führerbindung sowie Härte und Artverträglichkeit Attribute geeigneter Solojäger.
Hundeortung als Unterstützung im Drückjagd- Notfall
Insbesondere bei der Drückjagd zählt im Notfall jede Minute. Das Anfordern eines Fahrzeugs zur Hilfeleistung oder zum Transport war ohne Telekommunikation nur schwer möglich. Anhand grober Ortsangaben und markanter oder bekannter Örtlichkeiten wurden Helfer per Handy oder Funk zum Notfallort geleitet. Fatal, wenn es um Minuten geht! Durch die Tracker Hundeortung (auch veröffentlicht im Jägermagazin mit dem Titel die Jagdsymphonie) werden die exakten Standortdaten der Beteiligten mit allen App Nutzern geteilt. So ist es leicht und schnell möglich, Hilfe zu Menschen und Hunden zu navigieren. Genauso wie gedacht, funktionierte das bei einem geschlagenen Hund in der Test- Drückjagdsaison. Durch meine Position beim geschlagenen Hund konnte ich mithilfe der Tracker App in kürzester Zeit ohne Umwege einen Tierarzt mitten ins Treiben bringen lassen. Und das, obwohl die Örtlichkeit den anderen Beteiligten gänzlich unbekannt war und sogar in einer Dickung lag. Ohne Tracker wäre hier eine Zeit von mindestens 20 Minuten vergangen.

Hundeortung als Grundlage guter Drückjagden
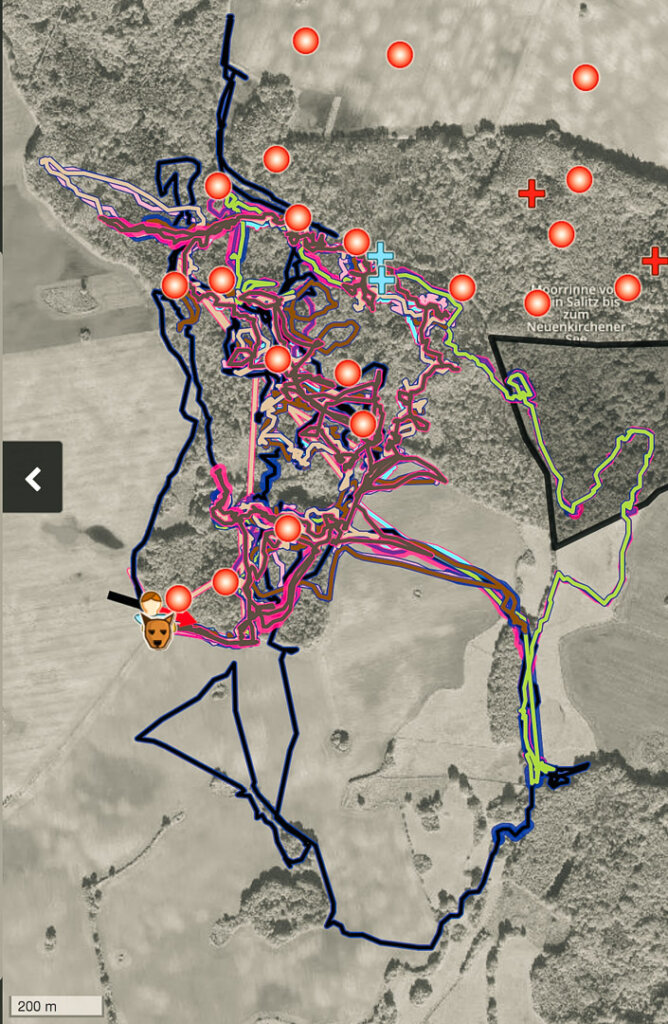
Gute und geprüfte Jagdhunde sind der Garant für Erfolg bei Drückjagden auf Schwarzwild. Bei der Jagd ist vieles unvorhersehbar. Deshalb schützen verantwortungsbewusste Hundeführer ihre Hunde nicht nur mit Schutzwesten gegen Schwarzwildangriffe, sondern versehen sie darüber hinaus mit moderner Hundeortung. Als Berufsjäger nutze ich selbst seit 2011 Hundeortungsgeräte im Praxiseinsatz. Zusätzlich habe ich im Rahmen verschiedener Langzeit-Tests für das Jäger- und Sauenmagazin nahezu alle am deutschen und skandinavischen Markt verfügbaren Ortungsgeräte intensiv genutzt und im harten Drückjagdeinsatz mit zahlreichen Hunden getestet.
Der grundlegende Unterschied der verschiedenen Ortungssysteme besteht im Wesentlichen in der Art der Datenübertragung vom Halsband zum Empfänger.
Funkbasierte Systeme (Garmin) nutzen VHF- Funk, andere (Tracker) nutzen das Mobilfunknetz oder auch eine Hybridlösung aus beiden Übertragungstechniken.
Mobilfunk oder Funk?
Beide Datenübertragungswege bieten Vor- und Nachteile, die im Testverlauf verdeutlicht wurden. Hundeortungssysteme sind bereits seit etwa 2007 in der Lage, dem Hundeführer die Position des Hundes halbwegs zuverlässig zu übermitteln. So waren verletze, geschlagene oder einfach Hunde, die sich verjagt hatten, auffindbar.
Die Ortungsqualität und der Umfang an Zusatzfunktionen sind in den letzten Jahren ebenso angewachsen wie Akkulaufzeiten, Empfangsstärke sowie die realistischen Übertragungsreichweiten. Nur Orten war einmal. Garmin und Tracker sind den meisten bekannt. B-Bark und Ultracom Novus waren wie Tracker auch, finnische Hersteller, deren Geräte ich bereits 2015 vor einer Markteinführung in Deutschland getestet habe. Mittlerweile hat Tracker beide Firmen aufgekauft und so fließt auch deren Technologie in das aktuelle Portfolio von Tracker ein. So bietet das R10i Hybrid sowohl Funk als auch eine Datenübertragung via Mobilfunknetz. Hierdurch ist neben der hohen Empfangsstärke eine sichere Kommunikation sichergestellt.

Abhängig vom Ort der Drückjagd

In Finnland ist sowie in allen Skandinavischen das Mobilfunknetz hervorragend ausgebaut, von der Taiga bis in die tiefste Tundra Lapplands hat man mindestens 3G oder eine schnellere Verbindung. Einen solchen „Luxus“ habe ich nicht mal vor meiner Haustür, 20 Kilometer vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. Durch den sehr guten, flächendeckenden Ausbau ist Tracker als finnischer Hersteller Marktführer in diesem Segment und entwickelte bereits sehr früh mobilfunkbasierende Geräte.
Garmin Hundeortung mit Funk
Garmin Geräte sind seit der Generation der Astro 320 Geräte mit T5 Halsbändern ein sehr starkes Produkt, wenn es um rein funkbasierte Datenübertragung geht.
Die Halsbänder empfangen GPS und Glonass Positionsdaten und übermitteln diese per Funk an den robusten Handempfänger. Das Handgerät zeigt die eigene Position sowie die des Hundes zuverlässig an. Je nach Wald und Belaubungszustand sowie Gelände reicht die Ortung bis zu 2,5 Kilometer, im freien Feld, ohne kupiertes Gelände sind sogar 7 Kilometer problemlos möglich. Die Akkulaufzeiten reichen problemlos für 1,5 Jagdtage, eher länger.
Kleine Jagden und Nachsuchen sind die Kernkompetenz des Systems. Ein offenes Problem besteht in der begrenzten Reichweite. Verlässt der Hund den Empfangsbereich des Handsenders, ist er schlicht weg und nicht mehr aktuell zu sehen, bis er sich wieder mit seinem Sendebereich nähert. Bleibt er verschwunden, hilft nur das Aufsuchen der letzten bekannten Position, um eventuell wieder in den Sendebereich zu kommen.

Mobilfunk- Empfangsgerät für Tracker

Die mobilfunkbasierten Geräte von Tracker benötigen ein Smartphone, worauf die Position des Hundes angezeigt wird. Das Halsband sendet seine Daten per Mobilfunk an einen Server des Herstellers. Hierdurch können sämtliche Jagddaten auch nach der Jagd noch abgefragt werden.
Diese Daten werden vom Hundeführer per Smartphone App vom Server angefordert in der App angezeigt. Vorausgesetzt, sowohl Handy als auch Halsband haben Empfang.
Beim Smartphone bestehet durch einen Vertrag eine Netzbetreiberbindung. Wenn kein Netz verfügbar ist, funktioniert das ganze System nicht, ebenso, wenn die Empfangsleistung des Handys zu gering ist. Um die Netzproblematik zu umgehen, bietet Tracker eine eigene Sim Karte an. Hierdurch agieren sowohl Handy als auch Halsband, als wären es ausländische Geräte. Großer Vorteil: Das Roaming. Hierdurch greifen die Geräte auf jedes verfügbare Netz zu. Minimalleistung ist so immer vorhanden und eine Ortung sichergestellt.
Durch die hohe Antennenleistung der Halsbänder stellt nur das Smartphone eine Schwachstelle des Systems dar.
Die persönliche Vorliebe der Hundeortung für die Drückjagd
Sämtliche Hundeortungsgeräte haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Sowohl Garmin als auch Tracker als Profi- Hundeortungsgeräte eignen sich hervorragend für die zuverlässige Hundeortung und bieten eine sehr hohe Qualität. Da es um die Sicherheit meines Hundes geht, setzte ich nur auf diese beiden Hersteller.
Letztlich entscheiden der persönliche Nutzen, die Nutzungsoptionen, der Anspruch und die verschiedenen Zusatzfunktionen sowie die Vorlieben darüber, welches Gerät der Hundeführer auf der Drückjagd nutzt. Garmins System eignet sich eher für kleine Gruppen und kurz jagende Hunde sowie Bereiche ohne Mobilfunknetzabdeckung. Tracker setzt mit den Zusatz- und Gruppenfunktionen im Bereich der Jagdorganisation Maßstäbe, der Mobilfunkempfang mit der Tracker- Sim liefert stets Empfang über das Roaming. Die unbegrenzte Reichweite sowie die unbegrenzte Anzahl an Hunden und Nutzern sind ein enormer Vorteil der mobilfunkbasierten Systeme.
Jedes System erfordert eine gewisse Einarbeitung, um den gesamten Funktionsumfang schnell und intuitiv nutzen zu können.

Die Checkliste für den Treiber und Hundeführer für die Drückjagd

- Gewehr mit Drückjagdoptik, abgeklebter Lauf
- Ausreichend Munition
- Futteral
- Signaljacke
- Sauenschutzhose
- Signalfarbene Cap
- Feste Drückjagdschuhe
- Gamaschen
- Handschuhe
- Messer
- Abfangmesser wie Saufänger
- Latexhandschuhe
- leichte Bergehilfe
- Einfache Hundeleine
- Ggf. Funkgerät
- Wechselkleidung
- Gültiger Jagdschein
- Waffenbesitzkarte
- Gültiger Schießnachweis gem. Landesvorgaben
- Personalausweis
Drückjagd Checkliste für den Hund
- Hundeleine
- Ortungsgerät mit Stromversorgung, geladen
- Hundeschutzweste
- Wärmeweste für nach der Jagd
- Warme Decken
- Handtuch zum Abtrocknen
- Hundefutter
- Wasser für Hund
- Napf
- Erstehilfe Pack mit Jubin und Klarsichtfolie
- Impfausweis
- Nachweis über Brauchbarkeitsprüfung für Drückjagden

Checkliste für die Drückjagd für den Schützen

- Gewehr mit Drückjagdoptik
- Ausreichend Munition
- Futteral
- Wetterfeste Jagdjacke
- Signalkleidung
- Warnwesten
- Signalfarbene Cap /Hut mit orangenem Hutband
- Drückjagdrucksack mit
- Sitzkissen
- Fernglas (8x42)
- Handwärmer
- Wärmesohlen
- Feste Drückjagdschuhe
- Messer
- Latexhandschuhe
- Bergehilfe
- Ggf. Gamaschen
- Wechselkleidung
- Gültiger Jagdschein
- Waffenbesitzkarte
- Gültiger Schießnachweis gem. Landesvorgaben
- Personalausweis
- Ggf. Powerbank mit Ladekabel
- Ggf. Akkus für Heizweste
- Ggf. Handschuhe oder Pulswärmer
- Kleine Flasche Wasser
Sicherheitsregeln für die Gesellschaftsjagd- 1
- Es wird ein Jagdleiter bestimmt. Seine Anordnungen sind bindend.
- Der Jagdleiter gibt allen an der Jagd beteiligten die erforderlichen Anordnungen für den gefahrlosen Ablauf der Jagd.
- Der Jagdleiter belehrt alle an der Jagd beteiligten vor Jagdbeginn entsprechend der UVV und gibt die Signale und/ oder Uhrzeiten bekannt.
- Die Waffe darf, sofern der Jagdleiter nichts anderes vorgibt, erst auf dem Stand geladen werden.
- Die Waffe wird unmittelbar nach Beendigung des Treibens entladen.
- Besonders unfallgefährdeten Personen (Geistig/ körperlich) wird die Teilnahme untersagt.
- Der Jagdleiter darf Aufgaben delegieren.
- Die Standschützen werden vom Jagdleiter oder einem beauftragten zu ihrem Stand gebracht und eingewiesen. Hierzu zählen insbesondere die einzuhaltenden Schussbereiche.
- Nach dem Einnehmen der Stände müssen sich die Schützen miteinander verständigen. Ist das nicht möglich, muss der Jagdleiter die Verständigung sicherstellen.
- Der Stand darf während des Treibens keinesfalls verändert oder verlassen werden. Der Jagdleiter kann Ausnahmen zulassen, der Schütze muss sich jedoch dann mit seinen Nachbarn verständigen.

Sicherheitsregeln für die Gesellschaftsjagd- 2

- Befinden sich Personen in gefahrbringender Nähe, darf in diese Richtung weder angeschlagen noch geschossen werden. Ebenso ist das Durchziehen durch die Treiberwehr verboten.
- Sofern der Jagdleiter keine Ausnahme aufgrund besonderer Verhältnisse und ausgeschlossener Gefährdung (Erhöhte Solitärstände- Drückjagdböcke- oder entsprechendes Relieff) zulässt, darf keinesfalls mit Büchsen- oder Flintenlaufgeschossen in das Treiben hineingeschossen werden.
- Jeder ist für seinen Schuss selbst verantwortlich.
- Außerhalb des Treibens ist die Waffe stets entladen, geöffnet und mit der Mündung nach oben zu tragen.
- Die Waffen der Durchgeh- und Treiberschützen sind ausschließlich mit entladenen Patronenlagern zu führen (Siehe dazu auch den Abschnitt in diesem Artikel). Der Einsatz ist nur für den Fangschuss, (den Schuss auf von Hunden gestelltes Wild) und den Selbstschutz erlaubt.
- Alle unmittelbar an der Gesellschaftsjagd beteiligten müssen sich farblich deutlich von der Umgebung abheben (großflächige Oberbekleidung in Signalfarbe z. B. Warnweste und Signalfarbene Caps).
- Bei schlechten Sichtverhältnissen wie starkem Schneefall, Nebel oder einsetzender Dunkelheit ist die Jagd einzustellen.
Checkliste für die Jagdleiteransprache bei der Drückjagd
Die Jagdleiteransprache mit Sicherheitsbelehrung erfolgt nach den Signalen Sammeln der Jager und Begrüßung. Zuvor sind bereits die Jagdscheinkontrolle sowie die Gruppeneinteilung/ Fahrzeugzuteilung und die Ausgabe und Anerkennung der UVV erfolgt.
- Begrüßung.
- Erläuterung des Jagdablaufes sowie der Art des Treibens.
- Freigabe mit Hinweis zu verwendender Munition/ Kaliber.
- Besondere Hinweise und Regeln sowie Hinweis auf besondere Gefährdungen.
- Konsequenzen bei Regelmissachtungen/ Disziplinlosigkeit (Ausschluss).
- Drückjagdteilnahme nur mit gültigem Jagdschein.
- Hinweis auf großflächige Signalkleidung für alle. Hutband reicht nicht.
- Hinweis auf Alkohol- und Drogenverbot.
- Alle Waffen sind außerhalb der Treiben entladen, geöffnet und mit der Mündung nach oben zu tragen.
- Bekanntgabe der Signale oder Zeiten für die Drückjagd mit Uhrenvergleich.


- Hinweis über den Ablauf der Wildbergung. Wild ist vom Schützen zum Stand zu ziehen.
- Belehrung über Kontaktaufnahme mit Nachbarn, wenn möglich.
- Sicherheitskontrolle des Standes vor dem Aufbaumen.
- Verbot, den Stand während der Drückjagd zu verlassen. Schützen werden vom Ansteller abgeholt.
- Einweisung über Schussbereiche sowie maximale Schussentfernungen.
- Hinweis auf Kugelfang- ausschließlich gewachsener Boden.
- Verbot des Durchziehens/ Anschlagens/ Schießens in Richtung von Personen in gefahrbringender Nähe.
- Jeder ist für seinen Schuss verantwortlich! Sicherheit geht vor Jagderfolg.
- Beginn und Ende des Treibens mit Hinweis ab wann/ bis wann geladen/ geschossen werden darf.
- Hinweis auf Entladene Patronenlager der Durchgehschützen und erlaubte Schussszenarien der Durchgehschützen.
- Information zur Rettungskette/ Unfällen, Verbandskästen in allen Fahrzeugen.
- Waidmannsheil und viel Anblick!
FAQ: Die häufigsten Fragen zur Drückjagd
Eine Drückjagd ist eine Bewegungsjagd auf Schalenwild. Das Wild wird hierbei durch Treiber, Hundeführer und die Jagdhunde aufgestöbert, auf die Läufe gebracht und möglichst den Schützen zugetrieben. In früher Zeit war die Drückjagd eher leise und ohne Hunde auf Rotwild ausgerichtet. Der Begriffe hat sich jedoch durch das mittlerweile häufige Schwarzwild gewandelt, welches deutlich mehr Hunde und Treiberlärm benötigt, um in Bewegung gebracht zu werden. Hunde
Der Ideale Zeitpunkt für die Drückjagd ist revier- belaubungs- und Wildbestandsabhängig und liegt im Zeitraum von Mitte Oktober bis spätestens Weihnachten.
Bei der Drückjagd wird heute zu Tage mit vielen Hunden und Treibern auf Schalenwild gejagt. Hierbei schießt der Jäger mit der Büchse. Bei der Treibjagd hingegen wird in ähnlicher Art- und Weise mit der Flinte auf Niederwild gejagt.
Die Drückjagd auf Schalenwild ist ein effektives Mittel, um in kurzer Zeit mit maximaler Unruhe im Revier eine maximale Jagdstrecke zur Abschussplanerfüllung zu erlegen. Hierdurch kann den Rest des Jahres bis auf die Einzeljagd Jagdruhe herrschen. Hiervon profitiert das Wild ebenso wie der Wald durch geringen Verbissdruck.
Der Schütze benötigt neben warmer, dem Wetter angepasster Bekleidung und der obligatorischen Signalkleidung und einer signalfarbenen Cap oder einem Hut ein Gewehr in drückjagdtauglichem Kaliber mit entsprechender Optik. Weiterhin wird ein Messer, ggf. eine Bergehilfe, ein Rucksack, Ersatzkleidung und festes Schuhwerk benötigt. Weitere Ausrüstung findest sich in diesem Beitrag weiter oben.
Die optimale Optik für die Drückjagd hängt von den Gegebenheiten ab. Rotpunktvisiere bieten maximal Übersicht, jedoch keine Vergrößerung. Als das Optimum empfinde ich Zielfernrohre mit einem Vergrößerungsbereich von 1,7-13,3-fach und 42 mm Objektivdurchmesser aus der Swarovski z6 und z8 Serie.
Als Drückjagdwaffe kann der normal genutzte Repetierer im Schalenwild/ Hochwildtauglichen Kaliber mit ausreichender Energiereserve genutzt werden. Eine weitere Waffe nur für Drückjagden ist nicht notwendig. Wichtig ist, dass der Schütze mit dem Gewehr sowie der Optik vertraut ist und den bewegten Schuss auf flüchtiges Wild sicher antragen kann. Hierfür ist neben dem richtigen Haltepunkt insbesondere ausreichendes Training wichtig.
Für die Drückjagd auf Schalenwild eignen sich Stöberhunde, Erdhunde wie Terrier und Teckel, aber auch Bracken und Vorstehhunde als Vollgebrauchshunde.
Ideal ist ein Drückjagdzielfernrohr mit variabler Vergrößerung, etwa auf dreifach eingestellt, werden die meisten jagdlichen Situationen sicher und mit der nötigen Übersicht beherrscht.
Als Drückjagdkaliber eignen sich insbesondere jene ab einem Geschossdurchmesser von über 7,5 mm. Ob .270 WSM ( 6,8 mm), .308 win., 30-06 Springfield, 8x57 IS oder 9,3x62 – hier entscheidet neben dem persönlichen Geschmack das bejagte Wild. Lieber etwas größer, jedoch gut beherrschbar ist der Grundsatz.
Nahezu jedes Aimpoint Rotpunktvisier ist für die Drückjagd geeignet. Mit einfacher Vergrößerung sollte eine persönliche Beschränkung auf 50 m Schussdistanz eingehalten werden.
Bleifreie und, wo erlaubt, bleihaltige Deformationsgeschosse haben sich für den Drückjagdeinsatz durchgesetzt. Deformationsgeschosse sind immer das Mittel der Wahl. Sie bieten neben einer erprobten und guten Tötungswirkung Richtungs- und Massestabilität und sorgen für Ausschuss.
Der Erleger des Schalenwildes auf der Drückjagd ist jener Schütze, der das Stück als erster getroffen hat. Unabhängig wie gut oder schlecht der Schuss war, und unabhängig davon, ob der Schuss tödlich war. Bei der Treibjagd auf Niederwild ist es andersherum, hier ist jener Schütze der rechtmäßige Erleger, der den tödlichen letzten Schuss auf ein Stück Niederwild abgegeben hat.
Das Vorhaltemaß hängt von der Entfernung zum Wild, von dessen Geschwindigkeit sowie dem verwendeten Kaliber ab. Aufgrund dieser Faktoren treffe ich zum Vorhaltemaß auf flüchtiges Wild keine pauschale Aussage. Das richtige Vorhaltemaß kann der Schütze nur mit seiner Waffe in seinem Kaliber auf den laufenden Keiler in variabler Geschwindigkeit adäquat trainieren und dann aus dem Gefühl heraus verwirklichen. Tabellen und Skizzen hierzu sind zu fern ab der Realität auf der Drückjagd.
Bei der Drückjagd wird das Schalenwild durch Treiber, Hundeführer und Jagdhunde aufgestöbert und den Schützen zugetrieben. Die Schützen erlegen dann das Wild entsprechend der Freigabe, in der Regel Frischlinge, Kälber, Kitze und den Abschussplan zu erfüllen und das hochwertige Lebensmittel Wild zu gewinnen.
Das Treiben einer Drückjagd sollte auf ein Maximum von drei Stunden begrenzt sein, um der zeitgemäßen Wildbrethygiene zu entsprechen und somit ein hochwertiges Lebensmittel sicherstellen.
Je nach Gegebenheiten kann eine Drückjagd bereits mit nur wenigen Treibern stattfinden. Bei großen Drückjagden nehmen neben den Hundeführern regelmäßig hohe zweistellige Anzahlen an reinen Treibern teil. Treiber benötigen bei der Drückjagd keinen Jagdschein, sie dürfen jedoch auch kein Wild erlösen oder Abfangen.
Alle Absolventen unserer Jagdschule sind immer zu unseren Alumnischießen willkommen, um dort für die Treibjagd auf Parcourstauben oder auf den Laufenden Doppelkeiler für die Drückjagd zu trainieren.
Neben den Kosten für den Jagdkurs für die Erlangung des ersten Jagdscheines fallen Ausrüstungskosten an. Hierunter fallen neben einer geeigneten Büchse, ein Fernglas, eine passende Zieloptik sowie entsprechende Kleidung für die Drückjagd. Hierzu finden sich viele Infos in diesem Blogartikel. Die Kosten für die komplette Drückjagdausrüstung beginnen bei ca. 3.000 Euro und steigen, je nach Hersteller, bis in den hohen fünfstelligen Bereich.